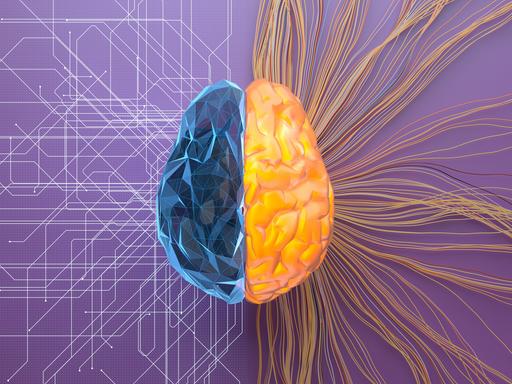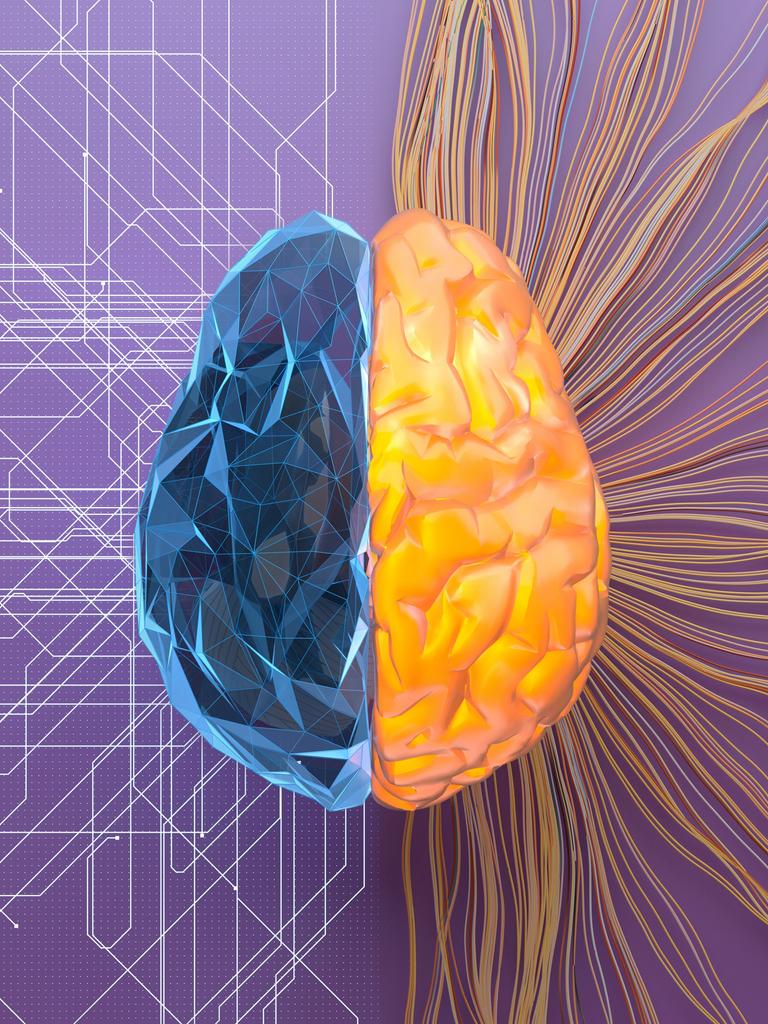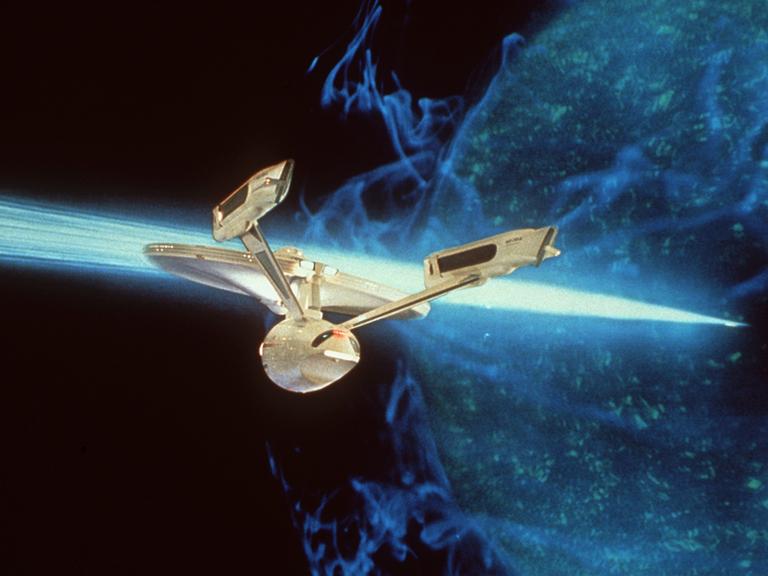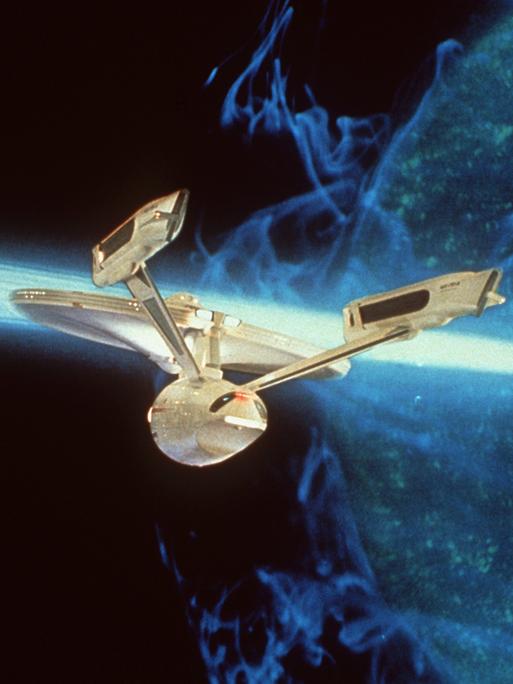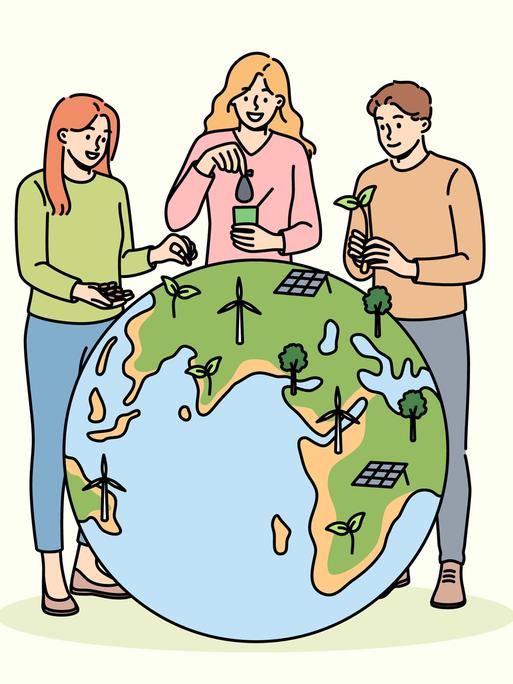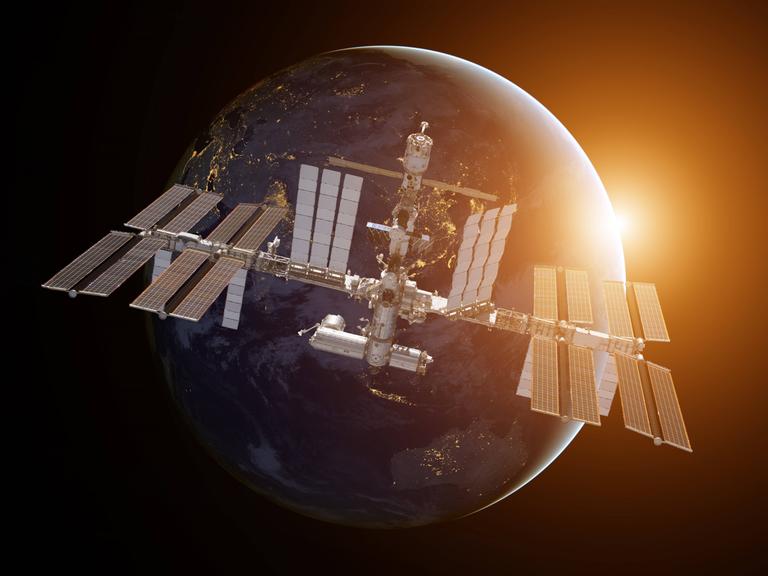Positive Utopien

Zukunftsvision: eine Stadt mit Hochhäusern aus Glas. Kann die Stadtplanung von Science-Fiction-Ideen profitieren? © picture alliance / Ikon Images / Oliver Burston
Mal was anderes als nur Weltuntergang

Wie blicken wir in die Zukunft? Kunst, Musik und Literatur schwelgen dabei oft in Dystopien, angesichts von Krieg und Klimakrise ist das auch verständlich. Doch ein bisschen Optimismus brauchen wir auch - und zum Glück zeigt sich der auch kulturell.
Der Kulturwissenschaftler Frederic Jameson hat es sinngemäß einmal so ausgedrückt: Der Kapitalismus habe es geschafft, dass man sich eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen kann.
Das hat auch Folgen für die Kultur, wo dystopische Erzählungen und Narrative oft ein pessimistisches Bild der Zukunft zeichnen, in der Regel, um vor Fehlentwicklungen zu warnen. Doch es gibt auch Gegenbeispiele, die eine nachhaltige Zukunft vorhersagen, Rassismus oder Geschlechterrollen infrage stellen und so Bilder entstehen lassen, wie eine andere, bessere Gesellschaft aussehen könnte.
Inhalt
Transmedia-Festivals
Musik ist Ausdruck von Kreativität und hat ein utopisches Potenzial. Das zeigt sich unter anderem bei Festivals. Hier kann eine temporäre Gemeinschaft entstehen; herkömmliche Regeln werden außer Kraft gesetzt. „Da geht es ganz konkret um temporäre Orte, die entstehen und die für eine kurze Zeit mit den Alltagsregeln brechen, neue Regeln etablieren und ein Außerhalb der Realität für eine kurze Zeit erlauben“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Bianca Ludewig.
Diese Erfahrung bleibt nicht örtlich und zeitlich beschränkt, wie der Künstler Forest Swords unterstreicht: „Du bist hier mit Gleichgesinnten und kannst über neue Ideen sprechen und gemeinsam Musik erleben. Davon nimmt man etwas mit: Es wirkt sich darauf aus, wie du mit Menschen umgehst, wie du Kunst machst.“ Die auf Festivals gelebte Utopie wird zur gemeinsamen Erfahrung, die bis in den Alltag reicht.
Räume abseits von Heteronormativität sind beispielsweise Transmedia-Festivals wie das „CTM“ in Berlin, die „Ars Electronica“ in Linz oder das „Rewire“ in Den Haag. Auf diesen feiert die queere Community; starre Vorstellungen von Geschlecht, Gender und Sexualität spielen hier keine Rolle. Transmedia-Festivals sind Räume der Diversität.
Stadtplanung und Science-Fiction
Science-Fiction ist der Zeit voraus. Dabei tritt nur selten ein, was in dem Genre erdacht wird – zumindest fliegen die Menschen immer noch nicht mit Autos durch die Gegend. Doch Sci-Fi-Geschichten können populäre Bilder schaffen, an die etwa die Stadtplanung anknüpfen kann, erläutert die Stadtplanerin Carolin Pätsch.
Pätsch hat zum Dialog zwischen medialen Welten und urbanen Räumen geforscht und stellt eines vorweg: Stadtplanung und Science-Fiction haben unterschiedliche Ziele. Science-Fiction will unterhalten, Stadtplanung soll gestalten.
Doch beide könnten eine Symbiose eingehen, sagt sie. Science-Fiction könne den Stadtplanern dabei helfen, ihre erarbeiteten Leitbilder zukünftiger Städte zu kommunizieren - um sie so für mehr Menschen zugänglich und verständlich zu machen.
Hinzukommt, dass in der Sci-Fi-Kultur schon früh über wichtige Fragen nachgedacht wurde - etwa wie sich Städte an den Klimawandel anpassen und nachhaltiger werden können, oder wie mit sozialer Ungleichheit umgegangen werden kann.
Solarpunk-Bewegung
Seit einigen Jahren gibt es die – nicht nur künstlerische – Bewegung Solarpunk. Dabei handele es sich um eine „Zukunftsvision, die das Beste verkörpert, was die Menschheit erreichen kann“, heißt es in einem Manifest. Angestrebt wird „eine post-knappe, posthierarchische, postkapitalistische Welt, in der sich die Menschheit als Teil der Natur versteht und wo saubere Energie fossile Brennstoffe ersetzt“.
Technologie wird als Chance gesehen, die Natur zu bewahren – ein Gegenentwurf zu apokalyptischen Dystopien. Dabei verbindet Solarpunk Aktivismus, Wissenschaft und Kunst. Vor allem als Teil der Science-Fiction-Literatur hat sich die Bewegung, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt, einen Namen gemacht.
Neben literarischen Werken nutzt die Bewegung auch andere kulturelle Ausdrucksweisen. Ein Videospiel ist geplant, zudem gibt es Comics und Illustrationen, in denen Städte im satten Grün sprießender Pflanzen prosperieren. Eine utopische Ästhetik, die aufzeigt, wie Zukunft auch aussehen kann.
Afrofuturismus
Die Zukunft ist Schwarz! Das zeigt die künstlerische Bewegung des Afrofuturismus. Sie liefert mit ihren Werken einen Gegenentwurf zu westlichen, weißen Narrativen. Dabei wird Science-Fiction mit postkolonialen Ideen kombiniert, eine selbstbewusste Schwarze Zukunftserzählung gegen die rassistische Normalität entsteht.
Ein Vertreter dieser Bewegung ist etwa der Comiczeichner Roye Okupe. Der nigerianische Künstler schickt seinen Superhelden Wale Williams ins Lagos der Zukunft, um für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen.
Ein anderer bekannter Schwarzer Comicheld ist Black Panther. Er tauchte bereits 1966 im Marvel-Universum auf – als König von Wakanda, ein technisch fortschrittliches afrikanisches Land. Die Geschichte wurde 50 Jahre später vom Autor Ta-Nehisi Coates fortgeschrieben, 2018 kam der Film „Black Panther“ in die Kinos.
Die Afrofuturismus-Bewegung erhielt ihren Namen zwar erst in den 1990er-Jahren, ist aber schon älter. Die Wurzeln liegen bereits in der Schwarzen US-Literatur des 19. Jahrhunderts, die noch immer aktuell ist. Auch Musiker wie Sun Ra werden zum Afrofuturismus gezählt. Mittlerweile gibt es auch einen Afrofuturismus 2.0, der sich als Dekolonialisierungsprojekt versteht.
Künstliche Intelligenz und Cyborgs
Neue Technologien bieten die Chance, gesellschaftliche Kategorien hinter sich zu lassen, das Bild einer anderen Gesellschaft zu entwerfen und eine Sprache zu finden, um das Neue auszudrücken. Ein Werkzeug dafür kann künstliche Intelligenz sein. Denn KI ist unabhängig von Körpern und geschlechtlichen Zuschreibungen.
Im Film und der Popkultur wird diese Utopie schon erzählt, dabei geht es nicht nur um KI-Systeme, sondern auch um Cyborgs – halb Maschine, halb Organismus, wie beispielsweise der Terminator. Doch auch wenn diese Wesen das Potenzial hätten, ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale auszukommen, werden sie von ihren Schöpfern oft noch immer männlich oder weiblich dargestellt.
Und so ist es auch mit der KI. Sie sei nicht neutral, unterstreicht Marie-Hélène Adam, die zu Technikutopien und Genderkonzepten promoviert hat. Die Technologie wurde mit bisher veröffentlichten Daten angelernt, und diese tragen die Vorurteile der bisherigen Welt in sich. Daher sei es wichtig, „dass mehr Geschichten erzählen werden, die differenzierter inszenieren“, betont Adam. Dann könne ein genderneutraler Blick auf die Welt real werden.
rzr