Verfechter eines starken Staates
Peter Bofinger tritt schon seit langer Zeit für einen starken Staat ein. Besonders vehement macht er das angesichts der Krise - so auch in seinem neuen Buch "Ist der Markt noch zu retten?"
Krisen verunsichern. Wenn die Wirtschaft boomt, hinterfragt den freien Markt niemand, nach dem Crash aber fast jeder. Im Zuge der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise scheint die Verunsicherung von Bürgern, Politikern und Intellektuellen jetzt riesengroß. Ist die Marktwirtschaft am Ende? Hat die Geschichte mit dieser Krise all jenen Recht gegeben, die dem Markt und dem Wettbewerb ohnehin nie vertraut haben?
Peter Bofinger, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, gibt sich optimistisch. Er wiegelt erst einmal ab:
"Bei aller Panik steht außer Zweifel, dass wir derzeit nicht das Ende des Marktes erleben. Die Weltwirtschaft wird wieder Tritt fassen."
Er preist die Krise als Chance:
"Sie ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, der ohne sie nur schwer zu erlangen ist."
Verunsicherung macht freilich auch empfänglich für Irrlehren. Und das ist auch jetzt wieder so, da die Debatte über Markt und Staat neu aufgebrochen ist. Die Frontstellungen scheinen unerbittlicher denn je.
Bofinger spielt das platte Spiel der Lagerkämpfe nicht mit. Zumindest tut der Würzburger Keynesianer so in seinem Buch, das er ostentativ in die Tradition der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft stellt. Gegen diese Vereinnahmung können sich Eucken, Erhard, Röpke, Rüstow nicht mehr wehren.
Bofinger will, wie er schreibt, nur verhindern, dass Demagogen die Menschen gegen Demokratie und offene Märkte in Stellung bringen. Überhaupt ist das Buch vom sanften Ton dessen getragen, der taktisch Kreide gefressen hat. Und doch bleibt es eine Polemik.
Denn Bofingers mahnender Verweis auf die Unfruchtbarkeit der Lagerkämpfe zwischen Freunden des Markts und denen des Staates ist bloß ein anbiederndes Ablenkungsmanöver. Wirklich unergiebig wäre nur eine Debatte zwischen kruden Anarchokapitalisten, die den Staat ganz abschaffen wollen, und Sozialisten altsowjetischer Prägung. Aber über diese Extrempole ist die Geschichte längst hinweggegangen.
Heute ist die Debatte viel weiter in der Mitte verortet, wo es nur noch um die Justierung der Gewichte von Staat und Markt geht, der eine dem anderen aber nicht die Daseinsberechtigung abspricht. Doch auch hier gibt es zwei Lager. Grob gesprochen besteht das eine Lager mehr aus denjenigen, die dem Staat mehr misstrauen als dem Markt, und das andere aus jenen, die dem Markt mehr misstrauen als dem Staat.
Was ist das eigentlich, Markt und Staat? Bei Lichte betrachtet sind beide nur Plattformen der Interaktion in der Gemeinschaft. Was sie unterscheidet, ist die Art, wie die Entscheidungen gefällt werden. Im Markt geschieht dies zwischen den Transaktionspartnern, freiwillig, zum gegenseitigen Vorteil. Der Preis, zu dem die Ware über den Ladentisch geht, ist ein spontanes Ergebnis. Über Preise werden Informationen produziert und verbreitet.
Das ist ein Ergebnis des Markts, das niemand im Voraus kennt oder auch nur simulieren kann. Der Markt schafft somit neues gesellschaftliches Wissen. Er ist evolutionär. Im Staat hingegen ist nichts evolutionär. Hier entwickeln sich die Dinge keineswegs spontan, hier wird gesetzt.
Hier wird über soziale Zustände kollektiv entschieden. Minderheiten werden von der Mehrheit zu Dingen gezwungen, die sie ablehnen. Es gibt keinen freiwilligen Tausch zum allseitigen Vorteil. Es gibt Benachteiligte. Das ist das Wesen von Herrschaft, und das bedeutet Statik.
Wer dem Staat mehr misstraut als dem Markt, erliegt daher auch nicht einem naiven Hang zur Vergötterung des Markts, wie Bofinger meint. Jeder Staatsskeptiker geht vielmehr von der Erfahrung aus, dass auch Politiker vor der Gier, Dummheit und Überheblichkeit, die Bofinger bei den Marktakteuren am Werk sieht, nicht gefeit sind.
Und dass autoritäre, auch durch demokratische Mehrheiten legitimierte Bestimmungen stets ein überlegenes Wissen voraussetzen, das aber in einem dynamischen Umfeld, wie es alle Gesellschaften sind, nicht zu haben ist – weil es nämlich erst entstehen muss. Wer so denkt, ist sich der Begrenztheit des menschlichen Wissens bewusst und bescheidet sich. Er setzt auf dezentrale, eigenverantwortliche Entscheidungen und schützt damit zugleich die individuelle Freiheit.
So denken Liberale. Wer umgekehrt dem Markt mehr misstraut als dem Staat, der fürchtet das scheinbare Chaos zentral ungesteuerter Entscheidungen und setzt lieber auf die höhere Vernunft eines hoffentlich wohlmeinenden und aufgeklärten Souveräns. So denken Rationalisten.
In diesem Lager positioniert sich Bofinger. Eigenverantwortung ist für ihn nur ein Schlagwort, unter dem der Staat seine Legitimation in Frage stellt. Für ihn bezieht der Markt seine Existenzberechtigung allein aus seiner Effizienzleistung, alles andere ist ihm fremd. Folglich fasst er den Staat auf als antikapitalistischen Willen und Vorstellung seiner Bürger:
"Er muss sich ihnen als eine Institution präsentieren, die die Interessen der Menschen wirksam gegen die Kräfte des Marktes durchsetzen kann."
Die eben noch schlau als verfehlt gegeißelte Frontstellung praktiziert Bofinger hier dann doch noch selbst.
"Die zentrale Einsicht aus den Entwicklungen der beiden letzten Jahre besteht in der Erkenntnis der ungeheuer selbst zerstörerischen Kräfte, die einem weitgehend unregulierten Marktsystem innewohnen können."
Zu diesem Schluss kommt nur, wer einer fulminanten Selbsttäuschung unterliegt. Schließlich war es ja gerade die Politik, die mit verfehlten Eingriffen die Märkte in die Krise geritten hat. Wodurch ist denn die Blase auf dem amerikanischen Immobilienmarkt zustande gekommen, wenn nicht durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Nachfrage und die lockere Geldpolitik? Bofinger wünscht sich nicht weniger davon, sondern eher mehr.
Er rennt an gegen das, was er als irrationale Angst vor staatlicher Überschuldung betrachtet, was aber in Wahrheit eher der letzte noch verbleibende kluge Instinkt des modernen Staatsbürgers sein dürfte. Im Übrigen kann von einem unregulierten Markt nicht die Rede sein. Gerade die Finanzmärkte sind stets scharf reguliert gewesen – nur gab es allzu viele politisch gewollte Ausnahmen von den allgemeinen Regeln. Offenbar gilt für Rationalisten auch der Satz, wonach nicht sein kann, was nicht sein darf.
Bofinger setzt sich ein für eine neue Ordnung der Weltwährungen, für eine staatliche Rating-Agentur, für eine fixe Eigenkapitalunterlegung für Banken, für eine Heuschreckensteuer, für die Wiedereinführung der Vermögensteuer, für den Rüttgers’schen Deutschlandfonds, gegen die Schuldenbremse, für eine Abkehr von der Lohnzurückhaltung und für Mindestlöhne.
Gegen all dies lässt sich ordnungspolitisch eine Menge einwenden, genauso wie gegen das von Bofinger geforderte neue Wachstumsmodell für Deutschland, das nicht den Export, sondern die Binnennachfrage vorzieht. Das ist noch so ein Märchen der Linken, der keynesianischen Rationalisten: als könnten wir einfach wählen, ob wir mit Auslands- oder Inlandsnachfrage wirtschaftlich wachsen. Was konsumiert wird, muss verdient werden. Und wenn wir auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind, schadet das niemandem. Im Gegenteil.
Das Buch kulminiert in einem moralischen Appell.
"Es geht darum, ein gleichermaßen rationales wie von Zuneigung und Engagement geprägtes Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat zu schaffen."
Bofinger wünscht sich, dass wir den Staat in Zukunft so wahrnehmen wie einen Allgemeinen Deutschen Bürgerclub, analog zum ADAC, der seinen Mitgliedern zur Seite steht, wenn es zu Unglücksfällen kommt. Dabei wäre etwas anderes doch wesentlich wichtiger: nämlich mehr gesunde Skepsis gegenüber kollektiven Entscheidungen; mehr Sorge um die individuelle Freiheit, die von einem ständig wachsenden und übergriffigen Staat bedrängt wird.
Dass man Zuneigung und Engagement für ein Gemeinwesen konstruktivistisch herstellen kann, das glauben ohnehin nur Rationalisten – in all ihrer erstaunlichen Anmaßung.
Peter Bofinger: Ist der Markt noch zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen
Econ Verlag, München/2009
Peter Bofinger, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, gibt sich optimistisch. Er wiegelt erst einmal ab:
"Bei aller Panik steht außer Zweifel, dass wir derzeit nicht das Ende des Marktes erleben. Die Weltwirtschaft wird wieder Tritt fassen."
Er preist die Krise als Chance:
"Sie ermöglicht einen Erkenntnisgewinn, der ohne sie nur schwer zu erlangen ist."
Verunsicherung macht freilich auch empfänglich für Irrlehren. Und das ist auch jetzt wieder so, da die Debatte über Markt und Staat neu aufgebrochen ist. Die Frontstellungen scheinen unerbittlicher denn je.
Bofinger spielt das platte Spiel der Lagerkämpfe nicht mit. Zumindest tut der Würzburger Keynesianer so in seinem Buch, das er ostentativ in die Tradition der Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft stellt. Gegen diese Vereinnahmung können sich Eucken, Erhard, Röpke, Rüstow nicht mehr wehren.
Bofinger will, wie er schreibt, nur verhindern, dass Demagogen die Menschen gegen Demokratie und offene Märkte in Stellung bringen. Überhaupt ist das Buch vom sanften Ton dessen getragen, der taktisch Kreide gefressen hat. Und doch bleibt es eine Polemik.
Denn Bofingers mahnender Verweis auf die Unfruchtbarkeit der Lagerkämpfe zwischen Freunden des Markts und denen des Staates ist bloß ein anbiederndes Ablenkungsmanöver. Wirklich unergiebig wäre nur eine Debatte zwischen kruden Anarchokapitalisten, die den Staat ganz abschaffen wollen, und Sozialisten altsowjetischer Prägung. Aber über diese Extrempole ist die Geschichte längst hinweggegangen.
Heute ist die Debatte viel weiter in der Mitte verortet, wo es nur noch um die Justierung der Gewichte von Staat und Markt geht, der eine dem anderen aber nicht die Daseinsberechtigung abspricht. Doch auch hier gibt es zwei Lager. Grob gesprochen besteht das eine Lager mehr aus denjenigen, die dem Staat mehr misstrauen als dem Markt, und das andere aus jenen, die dem Markt mehr misstrauen als dem Staat.
Was ist das eigentlich, Markt und Staat? Bei Lichte betrachtet sind beide nur Plattformen der Interaktion in der Gemeinschaft. Was sie unterscheidet, ist die Art, wie die Entscheidungen gefällt werden. Im Markt geschieht dies zwischen den Transaktionspartnern, freiwillig, zum gegenseitigen Vorteil. Der Preis, zu dem die Ware über den Ladentisch geht, ist ein spontanes Ergebnis. Über Preise werden Informationen produziert und verbreitet.
Das ist ein Ergebnis des Markts, das niemand im Voraus kennt oder auch nur simulieren kann. Der Markt schafft somit neues gesellschaftliches Wissen. Er ist evolutionär. Im Staat hingegen ist nichts evolutionär. Hier entwickeln sich die Dinge keineswegs spontan, hier wird gesetzt.
Hier wird über soziale Zustände kollektiv entschieden. Minderheiten werden von der Mehrheit zu Dingen gezwungen, die sie ablehnen. Es gibt keinen freiwilligen Tausch zum allseitigen Vorteil. Es gibt Benachteiligte. Das ist das Wesen von Herrschaft, und das bedeutet Statik.
Wer dem Staat mehr misstraut als dem Markt, erliegt daher auch nicht einem naiven Hang zur Vergötterung des Markts, wie Bofinger meint. Jeder Staatsskeptiker geht vielmehr von der Erfahrung aus, dass auch Politiker vor der Gier, Dummheit und Überheblichkeit, die Bofinger bei den Marktakteuren am Werk sieht, nicht gefeit sind.
Und dass autoritäre, auch durch demokratische Mehrheiten legitimierte Bestimmungen stets ein überlegenes Wissen voraussetzen, das aber in einem dynamischen Umfeld, wie es alle Gesellschaften sind, nicht zu haben ist – weil es nämlich erst entstehen muss. Wer so denkt, ist sich der Begrenztheit des menschlichen Wissens bewusst und bescheidet sich. Er setzt auf dezentrale, eigenverantwortliche Entscheidungen und schützt damit zugleich die individuelle Freiheit.
So denken Liberale. Wer umgekehrt dem Markt mehr misstraut als dem Staat, der fürchtet das scheinbare Chaos zentral ungesteuerter Entscheidungen und setzt lieber auf die höhere Vernunft eines hoffentlich wohlmeinenden und aufgeklärten Souveräns. So denken Rationalisten.
In diesem Lager positioniert sich Bofinger. Eigenverantwortung ist für ihn nur ein Schlagwort, unter dem der Staat seine Legitimation in Frage stellt. Für ihn bezieht der Markt seine Existenzberechtigung allein aus seiner Effizienzleistung, alles andere ist ihm fremd. Folglich fasst er den Staat auf als antikapitalistischen Willen und Vorstellung seiner Bürger:
"Er muss sich ihnen als eine Institution präsentieren, die die Interessen der Menschen wirksam gegen die Kräfte des Marktes durchsetzen kann."
Die eben noch schlau als verfehlt gegeißelte Frontstellung praktiziert Bofinger hier dann doch noch selbst.
"Die zentrale Einsicht aus den Entwicklungen der beiden letzten Jahre besteht in der Erkenntnis der ungeheuer selbst zerstörerischen Kräfte, die einem weitgehend unregulierten Marktsystem innewohnen können."
Zu diesem Schluss kommt nur, wer einer fulminanten Selbsttäuschung unterliegt. Schließlich war es ja gerade die Politik, die mit verfehlten Eingriffen die Märkte in die Krise geritten hat. Wodurch ist denn die Blase auf dem amerikanischen Immobilienmarkt zustande gekommen, wenn nicht durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Nachfrage und die lockere Geldpolitik? Bofinger wünscht sich nicht weniger davon, sondern eher mehr.
Er rennt an gegen das, was er als irrationale Angst vor staatlicher Überschuldung betrachtet, was aber in Wahrheit eher der letzte noch verbleibende kluge Instinkt des modernen Staatsbürgers sein dürfte. Im Übrigen kann von einem unregulierten Markt nicht die Rede sein. Gerade die Finanzmärkte sind stets scharf reguliert gewesen – nur gab es allzu viele politisch gewollte Ausnahmen von den allgemeinen Regeln. Offenbar gilt für Rationalisten auch der Satz, wonach nicht sein kann, was nicht sein darf.
Bofinger setzt sich ein für eine neue Ordnung der Weltwährungen, für eine staatliche Rating-Agentur, für eine fixe Eigenkapitalunterlegung für Banken, für eine Heuschreckensteuer, für die Wiedereinführung der Vermögensteuer, für den Rüttgers’schen Deutschlandfonds, gegen die Schuldenbremse, für eine Abkehr von der Lohnzurückhaltung und für Mindestlöhne.
Gegen all dies lässt sich ordnungspolitisch eine Menge einwenden, genauso wie gegen das von Bofinger geforderte neue Wachstumsmodell für Deutschland, das nicht den Export, sondern die Binnennachfrage vorzieht. Das ist noch so ein Märchen der Linken, der keynesianischen Rationalisten: als könnten wir einfach wählen, ob wir mit Auslands- oder Inlandsnachfrage wirtschaftlich wachsen. Was konsumiert wird, muss verdient werden. Und wenn wir auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind, schadet das niemandem. Im Gegenteil.
Das Buch kulminiert in einem moralischen Appell.
"Es geht darum, ein gleichermaßen rationales wie von Zuneigung und Engagement geprägtes Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat zu schaffen."
Bofinger wünscht sich, dass wir den Staat in Zukunft so wahrnehmen wie einen Allgemeinen Deutschen Bürgerclub, analog zum ADAC, der seinen Mitgliedern zur Seite steht, wenn es zu Unglücksfällen kommt. Dabei wäre etwas anderes doch wesentlich wichtiger: nämlich mehr gesunde Skepsis gegenüber kollektiven Entscheidungen; mehr Sorge um die individuelle Freiheit, die von einem ständig wachsenden und übergriffigen Staat bedrängt wird.
Dass man Zuneigung und Engagement für ein Gemeinwesen konstruktivistisch herstellen kann, das glauben ohnehin nur Rationalisten – in all ihrer erstaunlichen Anmaßung.
Peter Bofinger: Ist der Markt noch zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen
Econ Verlag, München/2009
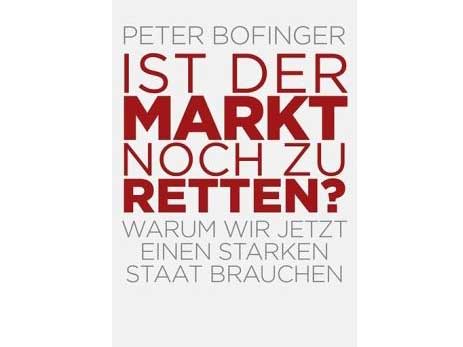
Cover: "Peter Bofinger: Ist der Markt noch zu retten?"© Econ Verlag
