Verfolgte "Mischlinge"
Während der Nazi-Zeit waren auch so genannte Mischlinge einer permanenten rassistischen Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Doch ihr Schicksal blieb der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. In "Im Schatten des Holocaust" berichtet der amerikanische Historiker James F. Tent über zahlreiche Einzelschicksale und über den neusten Stand der Forschung auf diesem Gebiet.
James F. Tent ist Professor für Geschichte an der Universität Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Auf das Thema "Mischlinge" im Dritten Reich stieß der Experte für deutsche Nachkriegsgeschichte durch einen Zufall. 1978 lernte er bei einer Bahnfahrt durch die DDR einen ehemaligen Mathematikprofessor kennen, der während der Nazi-Zeit als so genannter Halbjude verfolgt worden war. Stundenlang erzählte dieser Mann dem Historiker im Zugabteil von seinen Erfahrungen, und der Amerikaner war aufrichtig erschüttert. Das Thema verfolgte ihn, und in den 90er Jahren führte er umfangreiche Interviews mit Zeitzeugen. Das daraus entstandene Buch erschien im Jahr 2003 auf Englisch – und ist jetzt auch in einer erweiterten deutschen Fassung auf dem Markt.
Historikern ist die schleichende, aber zunehmende Diskriminierung von so genannten Mischlingen im Dritten Reich hinreichend bekannt. Doch Tent wendet sich nicht an ein Fachpublikum – seine Zielgruppe ist eine breitere Öffentlichkeit. Unter Kapitelüberschriften wie "Unschuldige im Klassenzimmer", "Bewerbungen von Mischlingen sind zwecklos" oder "Trennlinien und Mauern" erzählt er Einzelschicksale detailliert nach – Erlebnisse von Menschen, die als so genannte Nichtarier höhere Schulen verlassen mussten, die nur auf Widerruf die deutsche Staatsbürgerschaft behalten durften, die keine sexuellen Beziehungen zu Ariern unterhalten durften, die geschnitten, denunziert und in Zwangsarbeitslager gesteckt wurden - und die in ständiger Angst vor dem nächsten Schritt auf das Ende des Krieges warteten.
"Und weil sie natürlich Verwandte hatten, die schon als Juden in den Osten geschickt wurden und von denen man niemals mehr hörte, war es ihnen schon in ihren Kreisen und Familien bekannt, dass etwas Schreckliches dort im Osten passiert ist. Deswegen hatten sie immer die Angst: Was wird mit uns passieren? Und sie hatten mit vollkommenem Recht den Verdacht, dass sie früher oder später auch in die KZs beziehungsweise Vernichtungslager transportiert werden könnten."
Doch Tent bildet in seinem Buch nicht nur Einzelschicksale ab, sondern spiegelt auch den aktuellen Stand der Forschung wider. 72.000 Mischlinge ersten Grades ermittelte die Volkszählung 1939 im Großdeutschen Reich – die meisten von ihnen bekannten sich zum evangelischen oder katholischen Christentum. Diejenigen Mischlinge, die den Krieg überlebten und in Deutschland blieben - und das waren die meisten - konnten allerdings kaum mit Verständnis ihrer Umwelt rechnen.
"Erstens haben Leute öfters ihnen gesagt, nachdem sie ihnen ihre schrecklichen Erfahrungen erzählt haben: Ah, schweigen Sie, Sie haben es gar nicht so schlecht gehabt wie die Volljuden. Was stimmt, natürlich – sie sind am Leben geblieben, und die meisten Volljuden wurden ermordet. Zweite Reaktion war: Ach, Sie sind jüdisch! Und man soll nicht vergessen, dass Antisemitismus nicht nach 1945 ausgestorben ist – er blieb eine ganze Zeit da. Deswegen haben solche jungen Leute sich entschlossen, sie werden nichts mehr über das Thema reden ... und immer zu anderen freundlich sein, fast untertänig, aber nie profilieren."
Dem Buch "Im Schatten des Holocaust" ist auch in seiner deutschen Übersetzung die große Empathie anzumerken, mit der James Tent seine Interviews führte. Allerdings klingen umgangssprachliche Formulierungen an manchen Stellen salopp und klischeehaft– und zwischen erzählerischen und wissenschaftlichen Passagen besteht eine deutliche stilistische Diskrepanz. Dass James Tent seine Interviews ohne Aufnahmegerät führte, sich nur auf Mitschriebe stützte und den Zeitzeugen die Protokolle zur Bearbeitung und zur schriftlichen Genehmigung überließ, ist in der deutschen Forschung eher unüblich. Bei der Vorstellung des Buches im Berliner Jüdischen Museum sagte die Hamburger Historikerin Beate Meyer, Autorin des Standardwerkes "Jüdische Mischlinge: Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933 bis 1945":
"Für Amerikaner ist das Interview mit einem Verfolgten, mit einem Überlebenden meistens schon das, was es abzudrucken gilt. Wir kommen von der Oral History her, einem wirklich sehr kritischen Instrumentarium, das hängt auch mit der deutschen Geschichte zusammen, dass wir Zeitzeugen nicht sofort glauben; wir gehen dann lieber noch mal ins Archiv und gucken, was sagen denn die Akten über den aus ... und versuchen dann nicht, den Zeitzeugen zu widerlegen, darum geht es uns nicht, aber wir versuchen, die Diskrepanzen zu nehmen, von da aus zu interpretieren und Schlüsse zu ziehen."
Die Buchpräsentation im Jüdischen Museum wirkte teilweise fast wie ein Klassentreffen. Etwa ein Dutzend Menschen, die während des Dritten Reiches als "Mischlinge" eingestuft wurden, waren gekommen – darunter Ernst Benda, so genannter "Mischling zweiten Grades" und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, und mehrere emeritierte Wissenschaftler der Freien Universität Berlin. Wolfgang Lauterbach, 80 Jahre alt und ehemaliger Vertreter der "Herald Tribune" in Europa, musste im Alter von 16 Jahren als "Mischling ersten Grades" zwangsweise sein Berliner Gymnasium verlassen. Wie andere Zeitzeugen hat auch er die Arbeit von James Tent aufmerksam verfolgt:
"Ich habe die Rezension dieses zunächst englischsprachigen Buches in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, habe mir über amerikanische Verwandte das Buch schleunigst schicken lassen und bin daraufhin, nachdem ich es gelesen hatte, mit Herrn Professor Tent in Kontakt getreten und habe ihn beglückwünscht, weil das wirklich ein hervorragend dokumentiertes Buch ist. Hinzu kommt, dass ich auch das Gefühl bekam beim Lesen, dass er sich der Sache nicht nur als kühler, nüchterner Historiker gewidmet hat, sondern dass er auch ein warmes Mitgefühl für die Schicksale dieser Betroffenen hatte. Dieses Buch ist ein Buch, das auch in unsere deutschen Bibliotheken gehört, damit dieses Schicksal von Deutschen, die da ausgegrenzt wurden, auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird."
James F. Tent: Im Schatten des Holocaust
Schicksale deutsch-jüdischer "Mischlinge" im Dritten Reich
Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber
Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2007
Historikern ist die schleichende, aber zunehmende Diskriminierung von so genannten Mischlingen im Dritten Reich hinreichend bekannt. Doch Tent wendet sich nicht an ein Fachpublikum – seine Zielgruppe ist eine breitere Öffentlichkeit. Unter Kapitelüberschriften wie "Unschuldige im Klassenzimmer", "Bewerbungen von Mischlingen sind zwecklos" oder "Trennlinien und Mauern" erzählt er Einzelschicksale detailliert nach – Erlebnisse von Menschen, die als so genannte Nichtarier höhere Schulen verlassen mussten, die nur auf Widerruf die deutsche Staatsbürgerschaft behalten durften, die keine sexuellen Beziehungen zu Ariern unterhalten durften, die geschnitten, denunziert und in Zwangsarbeitslager gesteckt wurden - und die in ständiger Angst vor dem nächsten Schritt auf das Ende des Krieges warteten.
"Und weil sie natürlich Verwandte hatten, die schon als Juden in den Osten geschickt wurden und von denen man niemals mehr hörte, war es ihnen schon in ihren Kreisen und Familien bekannt, dass etwas Schreckliches dort im Osten passiert ist. Deswegen hatten sie immer die Angst: Was wird mit uns passieren? Und sie hatten mit vollkommenem Recht den Verdacht, dass sie früher oder später auch in die KZs beziehungsweise Vernichtungslager transportiert werden könnten."
Doch Tent bildet in seinem Buch nicht nur Einzelschicksale ab, sondern spiegelt auch den aktuellen Stand der Forschung wider. 72.000 Mischlinge ersten Grades ermittelte die Volkszählung 1939 im Großdeutschen Reich – die meisten von ihnen bekannten sich zum evangelischen oder katholischen Christentum. Diejenigen Mischlinge, die den Krieg überlebten und in Deutschland blieben - und das waren die meisten - konnten allerdings kaum mit Verständnis ihrer Umwelt rechnen.
"Erstens haben Leute öfters ihnen gesagt, nachdem sie ihnen ihre schrecklichen Erfahrungen erzählt haben: Ah, schweigen Sie, Sie haben es gar nicht so schlecht gehabt wie die Volljuden. Was stimmt, natürlich – sie sind am Leben geblieben, und die meisten Volljuden wurden ermordet. Zweite Reaktion war: Ach, Sie sind jüdisch! Und man soll nicht vergessen, dass Antisemitismus nicht nach 1945 ausgestorben ist – er blieb eine ganze Zeit da. Deswegen haben solche jungen Leute sich entschlossen, sie werden nichts mehr über das Thema reden ... und immer zu anderen freundlich sein, fast untertänig, aber nie profilieren."
Dem Buch "Im Schatten des Holocaust" ist auch in seiner deutschen Übersetzung die große Empathie anzumerken, mit der James Tent seine Interviews führte. Allerdings klingen umgangssprachliche Formulierungen an manchen Stellen salopp und klischeehaft– und zwischen erzählerischen und wissenschaftlichen Passagen besteht eine deutliche stilistische Diskrepanz. Dass James Tent seine Interviews ohne Aufnahmegerät führte, sich nur auf Mitschriebe stützte und den Zeitzeugen die Protokolle zur Bearbeitung und zur schriftlichen Genehmigung überließ, ist in der deutschen Forschung eher unüblich. Bei der Vorstellung des Buches im Berliner Jüdischen Museum sagte die Hamburger Historikerin Beate Meyer, Autorin des Standardwerkes "Jüdische Mischlinge: Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933 bis 1945":
"Für Amerikaner ist das Interview mit einem Verfolgten, mit einem Überlebenden meistens schon das, was es abzudrucken gilt. Wir kommen von der Oral History her, einem wirklich sehr kritischen Instrumentarium, das hängt auch mit der deutschen Geschichte zusammen, dass wir Zeitzeugen nicht sofort glauben; wir gehen dann lieber noch mal ins Archiv und gucken, was sagen denn die Akten über den aus ... und versuchen dann nicht, den Zeitzeugen zu widerlegen, darum geht es uns nicht, aber wir versuchen, die Diskrepanzen zu nehmen, von da aus zu interpretieren und Schlüsse zu ziehen."
Die Buchpräsentation im Jüdischen Museum wirkte teilweise fast wie ein Klassentreffen. Etwa ein Dutzend Menschen, die während des Dritten Reiches als "Mischlinge" eingestuft wurden, waren gekommen – darunter Ernst Benda, so genannter "Mischling zweiten Grades" und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, und mehrere emeritierte Wissenschaftler der Freien Universität Berlin. Wolfgang Lauterbach, 80 Jahre alt und ehemaliger Vertreter der "Herald Tribune" in Europa, musste im Alter von 16 Jahren als "Mischling ersten Grades" zwangsweise sein Berliner Gymnasium verlassen. Wie andere Zeitzeugen hat auch er die Arbeit von James Tent aufmerksam verfolgt:
"Ich habe die Rezension dieses zunächst englischsprachigen Buches in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, habe mir über amerikanische Verwandte das Buch schleunigst schicken lassen und bin daraufhin, nachdem ich es gelesen hatte, mit Herrn Professor Tent in Kontakt getreten und habe ihn beglückwünscht, weil das wirklich ein hervorragend dokumentiertes Buch ist. Hinzu kommt, dass ich auch das Gefühl bekam beim Lesen, dass er sich der Sache nicht nur als kühler, nüchterner Historiker gewidmet hat, sondern dass er auch ein warmes Mitgefühl für die Schicksale dieser Betroffenen hatte. Dieses Buch ist ein Buch, das auch in unsere deutschen Bibliotheken gehört, damit dieses Schicksal von Deutschen, die da ausgegrenzt wurden, auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird."
James F. Tent: Im Schatten des Holocaust
Schicksale deutsch-jüdischer "Mischlinge" im Dritten Reich
Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber
Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien 2007
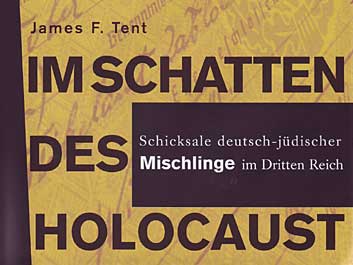
James F. Tent: "Im Schatten des Holocaust"© Böhlau Verlag