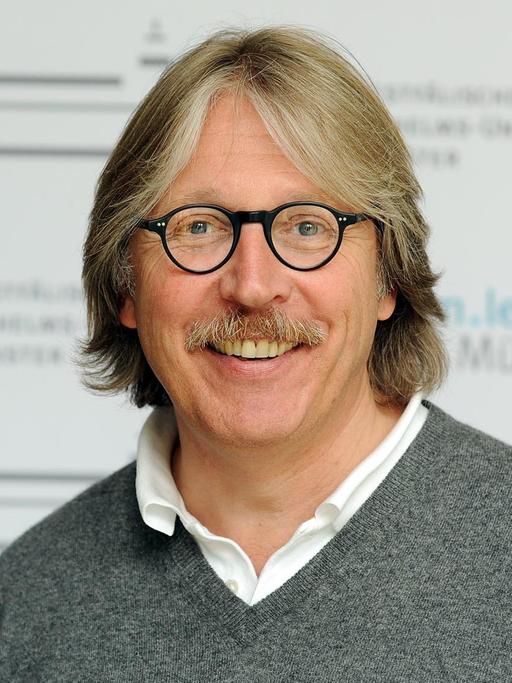Warum Tiere nicht die besseren Menschen sind

Schimpansen erkennen sich im Spiegel und können sich in andere Tiere hineinversetzen: Die Wissenschaft hat unser Bild der Tierwelt in den letzten Jahren revolutioniert, wie der Verhaltensbiologe Norbert Sachser aufzeigt. Er räumt aber auch mit romantisierenden Vorstellungen auf.
Dieter Kassel: Wenn Laien erklären sollen, was denn eigentlich so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Menschen und Tieren sind, dann ist ganz schnell die Rede von dem eigenen Bewusstsein, von Charaktereigenschaften, manch einer gräbt auch das Argument aus, es sei doch nun so, dass Tiere sich selbst grundsätzlich nicht im Spiegel erkennen könnten. Der eine oder andere sagt dann wieder, ist gar nicht so, mein Hund kann das. Es bleibt alles sehr im Vagen.
Wenn man aber Fachleute fragt, dann bleibt das zwar weniger im Vagen, aber vieles erstaunt einen, was man dann liest. Was man zum Beispiel liest im heute erscheinenden Buch von Norbert Sachser. Das Buch heißt "Der Mensch im Tier. Warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind". Norbert Sachser ist Professor für Zoologie und Leiter der Abteilung für Verhaltensbiologie an der Universität Münster, und wir wollen jetzt mit ihm unter anderem auch schlicht über diesen Buchtitel reden. Schönen guten Morgen, Herr Sachser!
Norbert Sachser: Guten Morgen, Herr Kassel!
Kassel: Der Mensch im Tier, das suggeriert ja, dass Tiere zu menschlichem Verhalten, Denken und Fühlen imstande sind. Aber wenn dieses Verhalten bei Tieren nachgewiesen werden kann, ist es dann überhaupt noch menschliches Verhalten?
Sachser: Was man als Wissenschaftler aber sieht, ist, dass wir in den letzten 30 Jahren über Tiere so viel dazugelernt haben, dass wir von einer Revolution des Tierbildes sprechen können, und dass heute, auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung, eine ganze Reihe von Eigenschaften und Fähigkeiten mittlerweile auch bei Tieren bekannt sind, die man vor wenigen Jahrzehnten noch ausschließlich dem Menschen zugeordnet hat.
Kassel: Welche denn zum Beispiel?
Sachser: Ein Beispiel wäre, ich bin noch groß geworden und habe gelernt in Vorlesungen in der Soziologie zum Beispiel und auch Philosophie: Kein Tier erkennt sich im Spiegel. Da müssen wir uns auch klar machen, ein einjähriges Kind kann das auch noch nicht. Ein einjähriges Kind, wenn es in den Spiegel schaut, hat keine Ahnung, was es sieht. Das geht erst so mit anderthalb Jahren los.
Und dann stellt man plötzlich fest, ein Schimpanse kann das, und ein Delphin kann das auch, und ein Elefant kann das auch, und andere Menschenaffen können das auch. Und vielleicht das Erstaunlichste in den letzten Jahren: Rabenvögel können das auch, wie die Elster zum Beispiel. Und das ist schon eine sehr große Überraschung.
Kassel: Aber mal ganz simpel gefragt, wie kann man so was wissenschaftlich nachweisen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Delfin auf sein Spiegelbild in irgendeiner Form reagiert, wie sind Sie sich sicher, dass der sich nicht nur denkt, ups, da ist ein anderer Delfin?
Sachser: Man macht den gleichen Test, den man mit Kindern auch macht. Man nimmt die gleichen Methoden, die man beim Menschen anwendet. Zum Beispiel, wenn man einen Schimpansen hat, macht dem einen roten Punkt ins Gesicht, den er selbst nicht sehen kann, und dann zeigt man ihm einen Spiegel. Und dann schaut man sich die Reaktion der Schimpansen an, und was man dann sieht, ist, der Schimpanse schaut in den Spiegel, fasst aber nicht in den Spiegel rein, sondern fasst direkt auf den Punkt, der sich in seinem Gesicht befindet.
Wenn Sie das mit einem Rhesusaffen zum Beispiel machen, der kann das überhaupt noch nicht. Der schaut in den Spiegel rein und fasst dann in den Spiegel. Das heißt, der Schimpanse hat eine Vorstellung davon, dass er das ist, wie es zweijährige oder anderthalbjährige Kinder auch haben. Der Rhesusaffe hat keine Ahnung, was er da sieht, wie es bei einem einjährigen Kind zum Beispiel auch der Fall sein könnte.
Kognitive Leistungen, die wir Tieren nicht zugetraut haben
Kassel: Da stellt sich aber sofort die Frage nach, wie wir bisher vielleicht geglaubt haben, menschlichen Charaktereigenschaften bei Tieren. Kann man denn zum Beispiel feststellen, dass die Tiere, die sich erkennen können im Spiegel, dass die zum Beispiel auch zu irgendeiner Form von Eitelkeit neigen?
Sachser: Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Ob ein Tier eitel ist oder nicht, hängt von der Definition von "eitel" ab. Ich würde jetzt nicht von Eitelkeit sprechen bei Tieren, aber was man sehen kann, ist, dass sie sich zum Beispiel, was man auch nicht für möglich gehalten hatte vor wenigen Jahren, in andere Artgenossen hineinversetzen können und dann die Welt aus deren Sicht sehen können und sich entsprechend verhalten. Da gibt es ganz ausgeklügelte Versuche zu, wo man tatsächlich zeigen kann, Schimpansen können sich in andere Tiere hineinversetzen.
Kassel: Eine Unterstellung, die ja gerade Tierfreunde dann immer ganz schnell haben, Tiere sind besser als Menschen, sie sind nicht böse, sie sind nicht berechnend. Ich muss sagen, das hat mich an Ihrem Buch doch ein bisschen auch enttäuscht, dass ich da – Sie haben gerade die Schimpansen erwähnt – lernen musste, das ist nicht so. Tiere können als Individuen sehr viel Eigennutz entwickeln, und das geht bis hin zum Mord, wenn das in ihrem Interesse liegt. Da bin ich doch der Meinung, das ist unschön – aber wahr?
Sachser: Das ist aus menschlicher Sicht, nach menschlichen Moralvorstellungen unschön, aber es ist wahr. Aber worum es in der Wissenschaft geht, ist, ein realistisches Bild von dem zu zeichnen, wie Tiere sind. Und was man zeigen kann in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die Tiere sind uns in vielen Bereichen näher geworden. Das eine ist, was wir eben angesprochen haben: Es sind kognitive Leistungen da, die wir ihnen nicht zugetraut haben. Wir können auch zeigen, es sind Emotionen – ich habe noch gelernt, über Emotionen bei Tieren kann man keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Wir wissen heute, dass Emotionen bei den Tieren da sind, die mit denen des Menschen bis in verblüffende Merkmale identisch sind.
Wir haben aber auch gelernt, dass dieses alte Bild, die Tiere sind die besseren Menschen, die bringen einander nicht um, wie wir Menschen das tun, dass das leider auch nicht stimmt. Wenn wir quer durchs gesamte Tierreich schauen oder auch insbesondere bei den Tieren bleiben, die uns biologisch am nächsten sind, den Säugetieren, dann sehen wir, dass die Tötung von Artgenossen zum eigenen Vorteil etwas sehr weit Verbreitetes ist. Löwen, wenn sie ein neues Rudel übernehmen, gehen dann gezielt hin und bringen die noch nicht entwöhnten Jungtiere ihrer Vorgänger um.
Schimpansen können sich zusammentun zu Gruppen von acht, zehn, fünfzehn Individuen, gehen dann zu anderen Gruppen hin, suchen sich gezielt einige wenige Tiere raus und bringen die ganz gezielt um. Das heißt, dieses "Ein Tier bringt den Artgenossen nicht um", dieses alte Dogma, das stimmt so leider nicht. Und wir gehen heute davon aus, dass sich Tiere nicht zum Wohle der Art verhalten, sondern Tiere tun alles, um mit maximaler Effizienz ihre eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Wenn Sie das mit Kooperation hinkriegen oder mit Helfern, dann machen sie das. Wenn das aber besser durch Drohen, Töten, Vergewaltigen geht, dann machen sie das Entsprechende.
Mit maximaler Effizienz die Gene weitergeben
Kassel: Gut. Nun haben wir gelernt, oder ich habe gerade gelernt aus Ihrem Buch allerdings vorher auch schon, Tiere sind eben nicht die besseren Menschen. Sicherlich auch nicht die klügeren, aber reden wir mal über Intelligenz, haben wir so richtig noch gar nicht getan. Da kann man ja auch feststellen, da hat es oft in der Geschichte des Verhältnisses Mensch/Tier Missverständnisse gegeben. Sie erwähnen zum Beispiel den "Klugen Hans". Das ist eine alte Geschichte von einem Pferd, bei dem es Hinweise darauf gab, es könnte rechnen. Konnte es am Ende nicht, aber das Erstaunliche ist, eigentlich war es ja noch fast besser.
Sachser: Ja. Wir haben also, was man beim Klugen Hans bis heute sehr schön sehen kann, ist, wenn man nur ein Tier hat, es könnte auch ein Hund oder eine Katze sein, und beobachtet das, dann kann man schnell zu dem Eindruck kommen, das Tier hat ja unglaubliche Leistungen, was das alles kann. Und das war bei dem Klugen Hans, der Besitzer war Wilhelm von Osten, der war fest davon überzeugt, wenn ich sage, "drei plus vier", dann weiß mein Pferd, dass das sieben ist. Weil wenn er sagt, drei plus vier, dann hat das Pferd siebenmal mit dem Huf gescharrt.
Aber wichtig ist die Frage, ist das jetzt eine wissenschaftlich haltbare Aussage? Und als eine Kommission das untersucht hat, stellte man fest, wenn keine Person mehr im Raum war, die die Lösung kannte der Aufgabe, dann konnte der Kluge Hans das auch nicht mehr. Das heißt, das Pferd war in der Lage, feinste Regungen, Anspannungen in der Körperhaltung von Personen wahrzunehmen, und erkannte daran, wann es mit dem Scharren aufhören musste und bei der richtigen Lösung war. Also, es hielt der wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand, diese Aussage.
Wenn wir aber diesen berühmten Hund Rico nehmen, der bei Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" ich glaube, 200 verschiedene Gegenstände auseinanderhalten konnte und dem bekannt war, wie diese Gegenstände hießen – wenn Frauchen sagte, hol den BVB, das war ein kleiner Ball in den Farben von Borussia Dortmund, dann suchte der aus 50 oder 60 Gegenständen gezielt diesen Gegenstand raus. Das ist dann aber von Wissenschaftlern überprüft worden, und dabei kam heraus, ja, das kann dieses Tier wirklich. Das heißt, wenn wir sicher sein wollen, welches die kognitiven Leistungen sind, dann müssen wir es mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen, die müssen reproduzierbar sein, und dann können wir auch glauben, dass diese Eigenschaften bei den Tieren vorhanden sind.
Mensch nicht die Krone der Schöpfung
Kassel: Herr Sachser, das, was Sie und natürlich auch viele andere Verhaltensbiologen inzwischen herausgefunden haben, über was wir zum Teil auch schon gesprochen haben, was folgt daraus eigentlich für das Verhältnis von Menschen zu Tieren, bis hin zum Tierschutz und zu Gesetzen?
Sachser: Da folgt sicherlich raus, dass wir uns nicht unbedingt als die absolute Krone der Schöpfung betrachten sollten, dass wir vielleicht etwas bescheidener sein sollten, dass wir von – die Tiere sind uns schon näher, als wir ursprünglich gedacht haben. Daraus folgt zum Beispiel auch, dass wir von den Tieren vielleicht öfters lernen können. Wenn wir bei den Tieren lernen, dass bei der Geburt oder am Ende der Kindheit zum Beispiel noch nicht vorherbestimmt ist, was aus ihnen wird, dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass das vielleicht bei Menschen der Fall sein könnte. Und wenn wir sehen, dass Tiere lernen können durch Erfahrungen während der Pubertät, dass sie sich friedlich und aggressionsfrei mit Fremden arrangieren können, dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass der Mensch dazu nicht in der Lage ist.
Und wenn wir bei Tieren sehen, dass das beste Mittel gegen Stress und Krankheit ist, eine gute Beziehung zu einem Bindungspartner zu haben, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das beim Menschen auch der Fall ist. Das ist das, was wir lernen können. Ihren letzten Punkt, den Sie angesprochen haben – wir sollten uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie unsere Beziehung zu den Tieren aussieht.
Es sind ganz sicher, nach allem, was wir über Tiere wissen, sind das ganz sicherlich keine Objekte, sondern es sind Mitgeschöpfe, wo wir uns sehr genau überlegen müssen, wie wir mit denen umgehen. Sie haben kognitive Leistungen, sie haben Gefühle, sie haben viele Reaktionen, die denen des Menschen entsprechen und identisch sind. Also muss man tatsächlich sich auch überlegen, wie gehe ich mit diesen Tieren um, wie sollte auch in einer Gesellschaft das Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Tieren überhaupt sein.
Kassel: Der Verhaltensbiologe Norbert Sachser. Sein Buch "Der Mensch im Tier" erscheint heute im Rowohlt-Verlag. Herr Sachser, herzlichen Dank für das Gespräch!
Sachser: Bitte sehr!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.