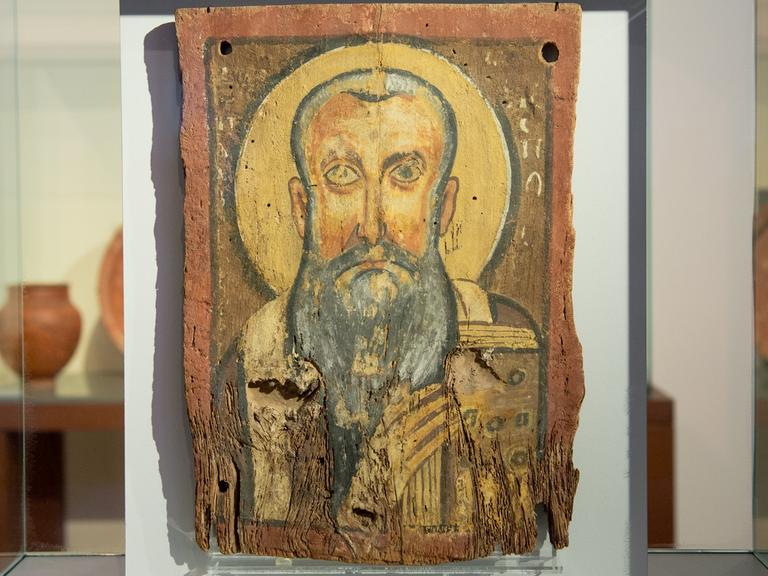Der Weltzeit-Podcast liefert Ihnen jede Woche seltene Einblicke in andere Länder. Hören Sie rein, wo es Fortschritte, Konflikte und Einzigartiges auf der Welt gibt.
"Frieden ist zum anstößigen Wort geworden"

Zwischen Israelis und Palästinensern herrschen Angst, Misstrauen und Hass. Und auch die israelische Gesellschaft ist tief gespalten, wenn es um Frieden mit den Palästinensern geht. Friedensorganisationen wie "Women Wage Peace" und "Combatants for Peace" haben es in diesem Klima schwer.
Hebron, Zone "H2": Sie ist nur durch Sicherheitsschleusen und Checkpoints zu erreichen. Es herrscht gespenstische Stille – wenn nicht gerade Militärjeeps durch die von Israel gesperrte Al-Shuhada-Straße fahren – einst eine belebte Einkaufsstraße, jetzt dient sie als Puffer: An jeder Ecke stehen schwerbewaffnete Soldaten, immer wieder kommt es zu tödlicher Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern.
Zone "H2", das bezeichnet seit 1997 den von Israel kontrollierten Teil in der größten Stadt im Westjordanland. Etwa 800 jüdische Siedler leben hier in "H2", aber auch 30.000 Palästinenserinnen und Palästinenser.
Ein gut zweitausend Jahre alter Monumentalbau ragt aus der Altstadt heraus – für Palästinenser ist er die Ibrahimmoschee, für jüdische Israelis die "Höhle der Patriarchen". Hier soll unter anderem der Urvater der drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam begraben liegen: Abraham.
Das Massaker des Baruch Goldstein
Und hier, in der Zone "H2", betreibt der Palästinenser Mohammed al-Mohtaseb seinen Souvenirladen. Neben einer Absperrwand erzählt Mohammed al-Mohtaseb vom 25. Februar 1994, ein für ihn zentrales Datum:
"Es war Ramadan, alle fanden sich zum Gebet in der Moschee ein – und währenddessen erschoss Baruch Goldstein vom hinteren Teil aus 29 Palästinenser und verletzte 150 von ihnen."
Baruch Goldstein, ein aus den USA immigrierter orthodoxer Jude und Arzt, versuchte erfolglos, zu entkommen, wurde noch in der Moschee getötet.

Palästinenser Mohammed al-Mohtaseb aus Hebron© Von Hilke Rusch
"Daraufhin schloss Israel die Moschee für neun Monate. Nach der Wiedereröffnung mussten die Leute herausfinden, dass ein Teil zur Synagoge erklärt worden war."
Israel habe das mit Sicherheitsüberlegungen begründet, fügt Mohammed al-Mohtaseb hinzu.
Auf der anderen Seite der Sicherheitswand, die das Gebäude teilt – also in dem Bereich, der als Synagoge genutzt wird – schüttelt Eliyahu McLean irritiert den Kopf. Zur Synagoge umgewandelt?, fragt er.
"Das war schon immer auch eine Synagoge. Was wir nach dem Massaker gebaut haben, war nur die Sicherheitswand."
Das Massaker von Hebron
Eliyahu McLean lebt im Süden Israels, versteht sich als Friedensaktivist. Er verurteilt die Terrorattacke des Rechtsextremisten Baruch Goldstein scharf. Doch wenn er über Hebron spricht, dreht sich ein Großteil der Erzählung um die jahrtausendealte jüdische Geschichte der Stadt, oft in friedlicher Koexistenz mit den arabischen Bewohnern.
Und von einem Massaker berichtet auch Eliyahu McLean, allerdings jenes von 1929: Begangen von Palästinensern, die durch die Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Nationalbewegung aufgewiegelt worden waren.
"Die muslimischen Araber drangen in die Häuser ein, riefen 'Tötet die Juden'. Mit Schwertern, mit Äxten, mit Messern wurden die Menschen umgebracht – von ihren arabischen Nachbarn."
67 Juden starben während des Pogroms, 58 wurden verletzt.

Eliyahu McLean, aus den USA eingewanderter jüdischer Israeli und Friedensaktivist.© Von Hilke Rusch
"Die Briten, damals die Mandatsmacht, vertrieben die Juden, meinten, sie könnten sie nicht schützen. Tausende Jahre jüdischer Präsenz in Hebron waren damit beendet. Nur die Kreuzfahrer hatten das vorher geschafft."
1968, nach dem Sechs-Tage-Krieg, ließen sich Jüdinnen und Juden erneut in Hebron nieder – der Beginn der Siedlungsbewegung im Westjordanland, die teils militant vorangetrieben wurde.
Hebron: Eine Stadt, zwei Geschichten
Für die Juden damals war es eine Rückkehr nach Hebron. Für Palästinenserinnen und Palästinenser eine Besetzung, die bis heute andauert und die sich ausdehnt.
Zwei Narrative, zwei Versionen der Geschichte. Mohammed al-Mohtaseb und Eliyahu McLean – bisweilen scheinen die beiden über zwei unterschiedliche Städte namens Hebron zu erzählen.
Tel Aviv, 17. April 2018. Israel begeht den Memorial Day: Im ganzen Land gedenken Israelis der in den Kriegen gefallenen Soldatinnen und Soldaten und der zivilen Opfer von Terrorismus – Menschen also, die durch Gewalt von Palästinenserinnen und Palästinensern starben.
Fast jeder in Israel hat irgendwann einmal Angehörige oder Freunde verloren. Diesen Tag mit einer gemeinsamen Zeremonie zu begehen, also auch der Toten "der anderen Seite", der Palästinenser, der "Feinde" zu gedenken, das ist für die allermeisten Israelis kaum vorstellbar. Und doch passiert es – Menschen beider Seiten kommen zum "israelisch-palästinensischen Memorial Day" zusammen.
"Es gibt viel Lärm und Aufruhr wegen unserer Zeremonie, aber lasst uns nicht vergessen: Es geht um das Erinnern und um Gemeinschaft."
"Wie leicht wäre es, dem Hass nachzugeben"
An diesem gemeinsamen Memorial Day sollen Trauer und Schmerz beider Seiten ihren Raum haben. Der Schriftsteller David Grossman gedenkt an diesem Tag seines Sohnes Uri, der im zweiten Libanonkrieg fiel.
"Ein junger, netter, lustiger Mann. Auch elf Jahre später ist es schwer, jetzt hier über ihn zu sprechen. Und wie leicht wäre es, dem Hass, der Wut, dem Wunsch nach Rache nachzugeben."
David Grossmann aber beharrt darauf, dass Trauer um Verlust eine geteilte Erfahrung sei, die Familien auf beiden Seiten verbinde. Zusammen mit 6000 Menschen nahm er an diesem Tag am israelisch-palästinensischen Memorial Day teil.
Ins Leben gerufen haben ihn vor 13 Jahren unter anderem die "Combatants for Peace", die "Kämpfer für Frieden": Eine binationale Gruppe, gegründet von Menschen, die aktiv am Konflikt beteiligt gewesen waren: Ehemalige israelische Soldaten und ehemalige Kämpfer von der palästinensischen Seite – Terroristen, wie sie in Israel gesehen werden.
Dem Feind die Hand zu reichen, war schwer
"Ich war 2005 dabei, als wir uns das erste Mal mit jenen Israelis trafen, die nicht mehr Teil der Gewaltspirale sein wollten. Das war hart. Es ist nicht einfach, dem Feind die Hand zu reichen."
Als der Sozialarbeiter Riad Hallis zu den ersten Treffen geht, hat er bereits Freunde und einen Bruder im Konflikt verloren. Er gehört zu jenen, die "Combatants for Peace" gründen – ein unvorstellbar großer Schritt für alle Beteiligten. Angst und Misstrauen dominieren kurz nach der zweiten Intifada auf beiden Seiten: Laufen wir in eine Falle? Werden wir entführt? Getötet?
"Es ist beängstigend. Und schmerzhaft: Du weißt ja nicht, was sie in der Armee gemacht haben – vielleicht hat einer früher einmal mein Haus angegriffen?"
Riad Hallis warf als Zehnjähriger während der Ersten Intifada Steine, später engagierte er sich in der Fatah-Jugend, organisierte "friedliche" Demonstrationen – für ihn hieß das damals, keine Waffen zu benutzen, sondern "nur" Steine und Molotow-Cocktails zu werfen.
Bei "Combatants for Peace" gehe es darum, zu lernen und zu beweisen, dass man die Spirale der Gewalt durchbrechen könne, sagt Riad Hallis. Wer Mitglied ist, verweigert sich dem Dienst in den besetzten Gebieten und verpflichtet sich zum gewaltfreien Widerstand.
Für ihre Arbeit wurde die Gruppe 2017 und 2018 für den Friedensnobelpreis nominiert: Sie organisiert Theaterworkshops, baut zerstörte Olivenhaine und Spielplätze wieder auf, veranstaltet Treffen zwischen Israelis und Palästinensern. Alle bekommen dabei Gelegenheit, ihre Geschichten zu erzählen und vom Narrativ des Gegenübers zu hören; die individuellen Menschen zu sehen statt eine feindliche Masse.
Abschied von alten Gewissheiten
Für viele bedeutet das einen Abschied von Überzeugungen und verinnerlichten Bildern – ein mitunter langer Weg.
Michal Hochberg, die in diesem Jahr den israelisch-palästinensischen Memorial Day mitorganisiert hat, kommt aus einer linken Familie, der väterliche Teil überlebte den Holocaust. Die Familie diskutierte viel über Frieden – aber die Furcht dominierte.
"Als Kind bekam ich jedes Mal Angst, wenn ich arabisch hörte. Die einzigen Palästinenser, die ich kannte, waren jene aus dem Fernsehen, sehr gewalttätig. Ich verstand nicht, warum sie uns töten wollten."

Teilnehmer einer Tour der Organisation "Breaking the Silence" auf den South Hebron Hills bei Susiya nahe Hebron.© imago / IPON
"Wir wollen Frieden, die Palästinenser nicht" – davon war Michal Hochberg überzeugt. Dieses Bild bekam erste Risse, als 1995 der damalige Premierminister Yitzhak Rabin von einem Gegner des Osloer Friedensprozesses, einem rechtsextremen Israeli, ermordet wurde. Aber erst Jahre später löste sie sich von alten Gewissheiten.
"Der Wandel begann in der Universität. Ein Jahr lang haben wir in einer Gruppe Artikel gelesen und Filme angesehen über die Situation zwischen Israelis und Palästinensern. Dann war ich das erste Mal im Westjordanland, auf einer Tour von der NGO Breaking the Silence. Für mich war es ein Schock, man lebt einfach in einer Blase, in den Medien kommt die Besatzung nicht vor."
Radikal: "Combatants for Peace"
Michal Hochberg suchte Anschluss und nach einer Möglichkeit, sich zu engagieren und fand "Combatants for Peace". Als deren Mitglied gilt sie heute vielen in der israelischen Öffentlichkeit als Verräterin.
Die Gruppe gehört zu jenen, die sich gegen die Besatzung einsetzen. Für viele Israelis undenkbar, denn der israelische Abzug aus dem Gaza-Streifen gilt nicht als geglücktes Beispiel: Seitdem regiert die Hamas, immer wieder gehen Raketen auf Israel nieder.

Michal Hochberg, Mitglied bei "Combatants for Peace" und Mitorganisatorin beim israelisch-palästinensischen Memorial Day 2018.© privat
Auch auf der palästinensischen Seite erleben die Mitglieder der Gruppe Drohungen, Arbeitgeber werden eingeschüchtert, Mitglieder gelten als "Kollaborateure" und "Normalisierer" und damit als Stütze der Besatzung.
"Combatants for Peace ist radikal in dem Sinne, dass sie mit Palästinensern zusammenarbeiten. Den älteren, liberalen, zionistischen Friedensbewegungen ging es um Frieden für Israels Sicherheit. Die jüngeren Bewegungen arbeiten gegen die Besatzung und für eine Zwei-Staaten-Lösung, um das Leben der Palästinenser zu verbessern."
Leonie Fleischmann von der City Universität London untersucht israelische Friedensbewegungen und ihren Wandel. Bis zur Jahrtausendwende gab es eine vitale Szene, einige größere Gruppen wie Peace Now sind über die Grenzen Israels hinweg bekannt geworden.
"Mit der zweiten Intifada brach alles zusammen, selbst Friedensaktivisten misstrauten den Palästinensern, waren überzeugt: Sie sind keine Partner für Frieden, schließlich gab es die ganzen Selbstmordattentate mit vielen Opfern auf israelischer Seite."

Ausschreitungen in Hebron im Oktober 2015© picture alliance / dpa / Abed Al Hashlamoun
"Nach der zweiten Intifada hat sich hier vieles verändert: Frieden ist zu einem anstößigen Wort geworden, die israelische Gesellschaft ist seit dem Jahr 2000 um einiges nationalistischer, religiöser geworden und das Militär aggressiver ..."
... meint die Soziologin Sara Helman von der "Ben Gurion Universität des Negev". National-Religiöse, Ultraorthodoxe, Säkulare – die jüdisch-israelische Gesellschaft sei tief gespalten; zwischen den verschiedenen Gruppen dominiere der Hass.
"Die Spannungen sind wahnsinnig groß. Ich glaube zwar nicht, wie einige andere, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt – so lange wir einen äußeren Feind haben und den Diskurs, dass wir von Ländern umgeben sind, die uns töten wollen. Die Regierung nährt diese Kultur der Angst, die hält alles zusammen. Aber wenn der Konflikt ruht, kommen die Spannungen an die Oberfläche."
Pragmatisch: "Women Wage Peace"
Seit der Gründung 2014 – während des letzten Gaza-Krieges – ist die Bewegung nach eigenen Angaben auf inzwischen 35.000 Mitglieder angewachsen. Ihr Ziel: So viel Druck aufbauen, dass sich die Regierung zu Verhandlungen mit der palästinensischen Führung aufrafft und mit ihr zu einem Friedensvertrag gelangt.
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo im Land Workshops, Diskussionsveranstaltungen, Filmscreenings oder Demonstrationen stattfinden. Bei "Women Wage Peace" kümmern sich Mitglieder in Ausschüssen um eine Zusammenarbeit mit palästinensischen Friedensinitiativen oder darum, Frauen aus unterschiedlichen Teilen der israelischen Gesellschaft zusammenzubringen: jüdische, arabische, christliche, arme Beduininnen wie rechte Siedlerinnen, sowohl Ashkenazi – also Jüdinnen mit Wurzeln in West- und Osteuropa – wie auch Mizrahi, Jüdinnen aus arabischen oder afrikanischen Ländern.
Auf einer Veranstaltung von "Women Wage Peace" in Tel Aviv verdeutlicht Nurit Haghagh, selber Mizrahi, wie umsichtig man dabei in einer segregierten Gesellschaft wie der israelischen sein muss.
"Organisiert man eine Veranstaltung an einem Freitagmorgen, schließt man Mizrahi-Frauen aus – sie bereiten das Schabbat-Essen vor. Wir müssen einfach ständig mitdenken: Wann und wo treffen wir uns, kostet es Geld, wer spricht, wer ist im Publikum vertreten?"
Die Bemühungen um Diversität sind offenbar erfolgreich: Im vergangenen Jahr kamen zum "Journey to Peace", der "Reise zum Frieden", 30.000 Menschen zur Abschlussdemonstration. Neben der Forderung nach Frieden verlangt die Bewegung die Umsetzung der UN-Resolution 1325: Frauen müssen gleichberechtigt in den Friedensprozess einbezogen werden.
Wie er allerdings aussehen soll, dieser Frieden – dazu bezieht "Women Wage Peace" keine Stellung. Angesichts der Spannungen in der israelischen Gesellschaft eine pragmatische Entscheidung, und wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb die Initiative so groß ist.
"Dass sich so viele Frauen für diese Gruppe begeistern und für Frieden engagieren, ist einerseits wundervoll, für mich ist das sehr wichtig ..."
... so Orna Sasson-Levy, Soziologie-Professorin an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan.
"Andererseits beziehen sie keine Position. Sie lassen sehr rechte Frauen sprechen, sie treten für keine spezifische politische Lösung ein – ich glaube, sie reden noch nicht einmal von 'Besatzung'."
Gesucht: eine neue politische Sprache
Wegen des schmalen Grats zwischen Kritik und Kompromiss, auf dem sich die Organisation bewegt, halten viele die Bewegung für unpolitisch. Hamutal Gouri, Geschäftsführerin des Dafna Fund, der feministische Aktivitäten fördert, sieht das anders.

Eti Livni, Mitglied von Women Wage Peace, bei einer Open-Stage-Veranstaltung der Bewegung in Tel Aviv 2018.© Hilke Rusch
"Wir arbeiten hart daran, eine neue politische Sprache zu entwerfen. Wir nennen das Politik des Sorgens, Politik des Kennenlernens, Politik der Diversität, Politik der Verunsicherung. Der politische Diskurs, wie wir ihn kennen, funktioniert nach 'teile und herrsche'. Das ist toxisch. Es ist deshalb unglaublich schwer, anderen Perspektiven, anderen Lebenserfahrungen 'radikal zuzuhören'. Das ist wie ein lange nicht genutzter Muskel."
Ob die Bewegung damit Einfluss auf die politische Sphäre hat, lässt sich schwer sagen. Regelmäßig steht die Initiative mit einer Gruppe vor der Knesset und erinnert an ihre Mission. Abgeordnete würden sich inzwischen dafür bedanken, dass die Frauen das Wort "Frieden" in den Diskurs zurückgebracht hätten. Für Sara Helman von der Ben Gurion Universität liegt hier die Stärke der Bewegung.
"Sie machen Basisarbeit, sie reden mit den Leuten, und das hat keine israelische Friedensbewegung zuvor getan. Vielleicht ist das der einzige Weg, um Schritt für Schritt die öffentliche Meinung zu verändern."
Sara Helman ist allerdings alles andere als optimistisch. Die israelische Regierung sei an einer Lösung nicht interessiert und Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas zu schwach. Fatah und Hamas gelten als korrupt, seit Jahren stehen in den palästinensischen Gebieten Wahlen aus und erst kürzlich hielt Präsident Abbas eine antisemitische Rede, in der er den Juden die Schuld am Holocaust gab und ihnen jede historische Verbindung zur Region absprach.
Einfache Antworten auf komplexe Realität
Zurück in Hebron. Gegenüber der komplexen Realität überwiegen derzeit die einfachen Antworten, die einfachen Narrative.
In einer kleinen Synagoge in der gesperrten al-Shuhada-Straße plädiert der Israeli Eliyahu McLean für einen differenzierten Blick. Die Synagoge, in der er steht, ist Teil des Hadassah-Hauses – das erste, 1979 von Siedlern illegal bezogene Gebäude in der Altstadt Hebrons. Ein Mosaiksteinchen im aktuellen Konflikt: Für die Palästinenser eine Besetzung, denn nach dem Pogrom an den Juden 1929 wurde das Haus als arabische Schule genutzt. Für die Juden damals eine Rückkehr, denn gebaut wurde das Hadassah-Haus Ende des 19. Jahrhunderts von Juden.
Geschichte ist kompliziert. Aber ihre Widersprüche sollten, wenn es nach Eliyahu McLean ginge, Eingang in die Narrative finden.
"Schulkinder, Soldatinnen und Soldaten, sie alle kennen die Bilder vom Massaker 1929. Wie viele fragen mich: Wie kannst Du Mohammed, wie kannst du Ibrahim trauen, erinnerst Du Dich an Hebron 1929? Aber sie übersehen ein Kapitel der Geschichte: Hunderte Juden überlebten, weil Palästinenser ihre jüdischen Nachbarn schützten."
Das Museum des Hadassah-Hauses, meint Eliyahu McLean, müsse um die Worte eines Palästinensers ergänzt werden, der dem Lynchmob 1929 den Zutritt zu seinem Haus verwehrt haben soll:
"In großen Buchstaben sollte das hier stehen: Nur über meine Leiche, diese Juden sind meine Familie. Wäre das nicht ein starkes Zeichen?"
Aber: Bislang fehlen diese Worte an den Museumswänden. Und während "Women Wage Peace" mit einer nicht sonderlich großen medialen Aufmerksamkeit zu kämpfen hat, sind "Combatants for Peace" mit Angriffen konfrontiert: Im vergangenen Jahr bewarfen Protestierende die Teilnehmenden des israelisch-palästinensischen Memorial Day mit Urinbeuteln. In diesem Jahr musste erst das Oberste Gericht durchsetzen, dass die palästinensischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einreisen konnten.