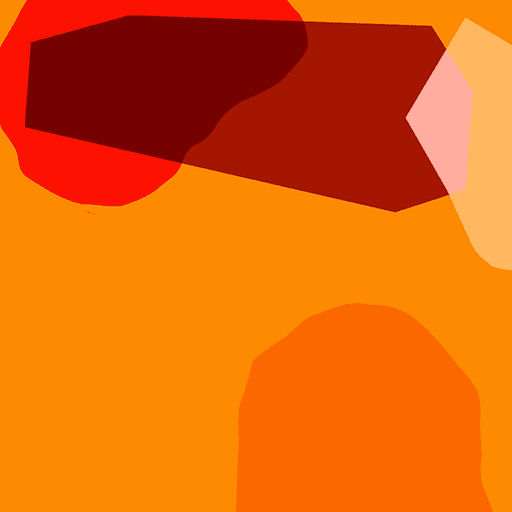Auch die Musik kennt Dialekte
29:58 Minuten

In dieser Sendung wird aufgeblättert, wie sich der Sprachraum, in dem sich ein Komponist bewegte, auf sein "Taktgefühl" auswirkte. Vor allem in der Barockzeit gab es unzählige Dialekte. Und diese spiegeln sich in der Musik - eine Hör-Sprachreise in die Musik.
Musik als "Klangrede" zu begreifen, das entspricht spätestens seit Nikolaus Harnoncourts gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1982 einem gängigen Verständnis von barocker Tonkunst. Inwiefern diese "Rede" aber auch lokale Dialekte kennt, und auf welche Weise der musikalische Zungenschlag mit der regionalen Mundart und deren Rhythmus zusammenhängt, das gehört zu den bislang kaum beackerten Feldern der Musikforschung.
Vor der Sprachangleichung
Lange vor der Uniformierung der Sprachräume durch die Wörterbücher des 18. und 19. Jahrhunderts beherbergten die Regionen noch eine Unzahl verschiedener Dialekte, und wenn man Francois Couperins Zeugnis aus dem Jahr 1717 glauben will, dann steckte hinter jeder der unterschiedlichen Sprechweisen und Jargons auch eine ganz spezielle musikalische "Inegalité".
Wie weitreichend sich Versmaß und mundartlicher Schlendrian ins Schaffen der zeitgenössischen Musiker eingraviert haben – das dokumentiert die Sendung von Wolfgang Kostujak.