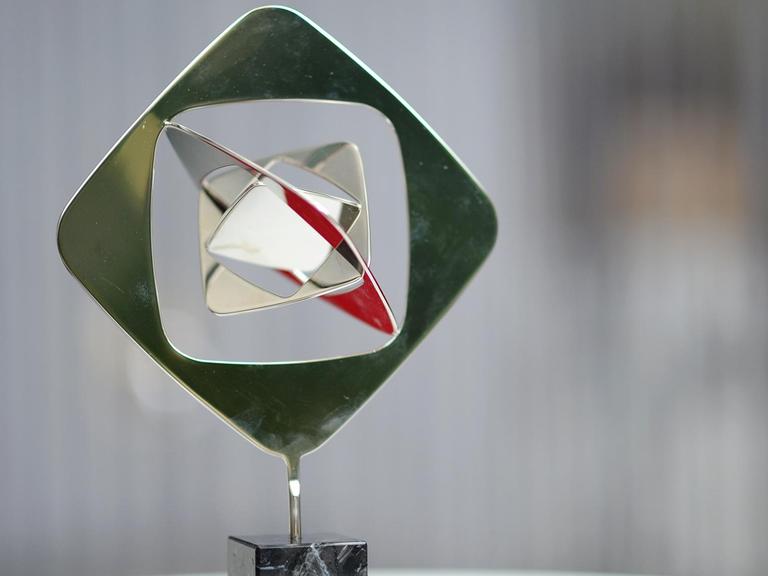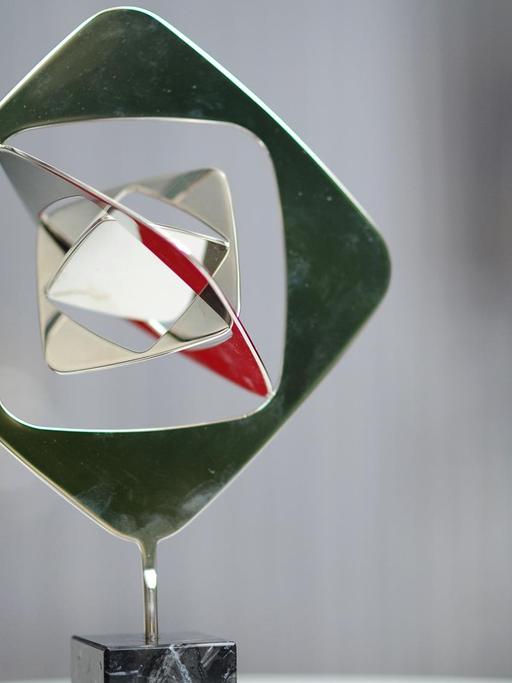„Für uns waren die Stoffe wichtig, die auf der Straße lagen“

Um 1968 herum ging es im Fernsehen um nichts weniger, als das nationale Narrativ zu gestalten, sagt der TV-Dramaturg Martin Wiebel. Heute regiere vor allem die Quote. Dabei sei die Wirklichkeit so brisant, dass sich die Sender nicht wegducken dürften.
Liane von Billerbeck: Beim Wort „Deutsches Fernsehen“, da winken viele Menschen inzwischen nur noch ab. Viele gucken Serien nur noch im Bezahlfernsehen, dabei hatte sich das Fernsehen damals nach 1968 in der Bundesrepublik verändert. Klar, die Bedingungen waren völlig anders, dennoch wollen wir in unserer 68er-Reihe danach fragen, was sich da geändert hat und was von diesem Fernsehen von damals übrig geblieben ist. Und wir tun das im Gespräch mit dem Dramaturgen, Fernsehredakteur, Filmproduzenten, Akademiepräsidenten, preisgekrönten Dramaturgen Martin Wiebel, der bei mir im Studio war. Ich grüße Sie!
Martin Wiebel: Ich grüße Sie, guten Tag!
von Billerbeck: Zuerst die große Frage vom Balkon, wie man im Radio sagt: Sie haben ja im Theater angefangen, bevor Sie zum Fernsehen gegangen sind – warum war das um 68 herum so verlockend?
Wiebel: Das Verlockende war, eine Bühne zur Auseinandersetzung mit der Zeit zu bekommen, die größer ist als die Theaterbühne, bei der man schon das Gleiche wollte. Ich habe am Theater Freie Volksbühne in Berlin bei Piscator angefangen, und plötzlich bot sich – für mich überraschend, denn ich hatte keine Ahnung vom Fernsehen – eine Offerte, die man unbedingt nutzen wollte.
Und ich hab sie extensiv schon damals genutzt. Die ersten Produktionen, die ich gemacht habe, waren mit Hans Magnus Enzensberger, mit Thomas Bernhard und dem Skandalfilm „Rote Fahnen sieht man besser“. Also, mehr Wirkung war mit dem Fernsehen zu erzielen, und die war das, was der innere Auftrag war.

Martin Wiebel war beim Theater Freie Volksbühne, bevor er zum Fernsehen kam.© Matthias Funk / Deutschlandradio
von Billerbeck: Was war denn die Hoffnung, die Sie hatten, abgesehen vom Millionenpublikum, also mehr Leute, die Ihre Sachen sehen, als im Theater, was war denn die Hoffnung auf dieses Fernsehen?
Wiebel: Im Grunde war es der Versuch, das nationale Narrativ zu gestalten. Worüber sollen die Leute reden, was soll ihnen das Fernsehen als Thema anbieten, mit dem sie sich auseinandersetzen könnten. Den Bildschirm eben, ich weiß nicht, wie einen Spiegel der Zeit zu nutzen, sodass die Menschen sich selber, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ängste verhandelt sahen, aber sozusagen nicht im Diskurs, nicht im politischen Dialog, sondern in der Form des Erlebnisses, in einem Fernsehspiel, in einer Kunstform.
Das heißt, für uns waren die Stoffe wichtig, die Stoffe, die auf der Straße lagen – wo sie übrigens heute immer noch liegen, neue Stoffe natürlich, nur heute fasst sie keiner mehr an. Damals war das, wenn man so will, die Hauptaufgabe, einen vorhandenen Dialog in der Gesellschaft oder einen, den man anstoßen wollte, mit der Produktion eines Fernsehspiels zu gestalten.
Und das hat unheimlichen Spaß gemacht, hat riesige Wirkung gehabt. Nehmen Sie nur als Beispiel, der Westdeutsche Rundfunk beauftragt nach einer ausführlichen Recherche, wie denn die Arbeitswelt zurzeit in Umbruch war, Rainer Werner Fassbinder mit der Gestaltung einer Familienserie – ein Mensch, der damals noch relativ unbekannt war, und der schreibt, „Acht Stunden sind kein Tag“. Darüber redet die Nation ein halbes Jahr.
von Billerbeck: Das klingt wirklich nach seligen Zeiten.
Wiebel: Das sind selige Zeiten gewesen.
von Billerbeck: Keine Geldsorgen und endlose Freiheiten. Haben Sie das so empfunden?
Wiebel: Ich kann von mir sagen – wer kann das schon –, in meinem gesamten Berufsleben habe ich alles, was ich machen wollte, gemacht. Mir ist nie etwas verboten worden, mir ist nie etwas verunmöglicht worden. Manches hat sich die Länge gezogen und verlangte energischen Kampf und Einsatz für das Projekt. Also man brauchte, je länger ich arbeitete, immer mehr Energie, um durch immer neue Türen gehen zu müssen, wenn welche verschlossen waren, aber die Energie, durch Türen zu gehen, ist auch die Voraussetzung für diesen Beruf gewesen.
„Es wird nach Nachfrage organisiert und nicht nach Angebot“
Aber in der Tat, das Fernsehspiel oder die fiktionale Unterhaltung heute steht – da hat der Zahn der Zeit heftig dran genagt – unter vor allem einem ökonomischen Druck, und dieser ökonomische Druck ist durch eine Umverteilung sozusagen organisiert worden. Es wird nicht mehr in den Häusern selber produziert, sondern man vergibt an Auftragsproduzenten.
Das ist eine kommerzielle Angelegenheit, und so ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dessen Auftrag sich bis heute nicht verändert hat, es ist der gleiche wie 1968, aber die Organisation davon ist total kommerzialisiert. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich auf dieser glitschigen Rutsche des Marktes. Und das Programm wird organisiert – Achtung! Reizwort Einschaltquote –, es wird nach Nachfrage organisiert und nicht nach Angebot.
von Billerbeck: Und die Verhältnisse haben sich seitdem ja enorm geändert, das muss man ja bitte schön auch mal einfügen. Es gibt das Privatfernsehen, das Internet, es gibt die Bezahlkanäle. Wir haben inzwischen Anbieter von Fiktionen, die das sehr gut machen – also Netflix hat ja wahnsinnige Serien geliefert –, aber ich will mal so ein bisschen dagegenhalten, dass Sie sagen, es geht nur noch Kommerz, das öffentlich-rechtliche Fernsehen erfüllt quasi die Aufgabe nicht mehr. Das klingt ja so durch, weil Sie sagen, die Aufgabe hat sich nicht geändert seitdem.
Es gibt ja auch Serien wie „Babylon Berlin“, es gab „Bad Banks“, es gab „Die Protokollantin“, das sind ja Produktionen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also das Fernsehen, mit drin war. Die waren ja durchaus erfolgreich und haben ihr Publikum gefunden. Das spricht doch dafür, dass da durchaus noch die Fähigkeit vorhanden ist, so etwas zu tun.
Wiebel: Nun haben Sie sozusagen drei exzeptionelle Stücke – gegen die man übrigens auch noch Einwände erheben könnte –, Sie vergessen dabei sozusagen das trocken Brot der täglichen Programmwoche. Und da werden Sie mir schnell zustimmen, dass Sie vor Krimis sich nicht retten können.
von Billerbeck: 140 Krimis pro Woche etwa.
Wiebel: Ja. Man geht auf ein Genre, weil man weiß, das funktioniert, dieses Angebot klappt immer. Die politischen Stoffe versteckt man in die „Tatort“-Dramaturgie, weil sie ansonsten überhaupt keine Chance mehr haben, bewilligt zu werden.
„Statt Puderzuckerdosen wird es wieder um harten Zwieback gehen“
von Billerbeck: Woran liegt das?
Wiebel: Das liegt an der Ängstlichkeit der Administration. Es geht darum, dass die Stoffe, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen behandeln müsste, wenn sie nicht in so eine neue Erzählweise wie diese Serienmuster verpackt werden, eigentlich gar nicht zur Geltung kommen.
Sie liegen auf der Straße, die Angst um die Zukunft der Arbeitsplätze, die Veränderung der Familienstrukturen, all das, was mit Zukunft zu tun hat und mit Fantasie bearbeitet werden könnte – was kann man machen, wie könnte es auch anders sein, welche Utopien sind denn eigentlich denkbar, oder sind wir nur noch den Sachzwängen ausgeliefert –, all das könnte fiktionale Unterhaltung machen.
von Billerbeck: Könnte es denn sein, dass das, was Sie sich wünschen aus der Zeit, die Sie das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche, geprägt haben in diesem fiktionalen Bereich, könnte es sein, dass das wieder zurückkommt, oder meinen Sie, das ist für alle Zeiten perdu?
Wiebel: Nein, aber nicht das Fernsehen wird das erreichen, sondern die Wirklichkeit wird das erzwingen. Die Wirklichkeit, die politische, die gesellschaftliche, ist so brisant, wie wir ja jeden Tag merken, dass das Wegducken, das die Politik betreibt, für die Künstler eigentlich nicht mehr möglich ist.
Die Wirklichkeit wird erzwingen, dass statt Puderzuckerdosen es wieder um harten Zwieback gehen wird und dass man Stoffe haben will, an denen man sich reiben kann. Dafür braucht es allerdings auch Redakteure und Kollegen, die das machen. Deswegen habe ich neulich mal einen langen Artikel mit einem Kollegen geschrieben, da stand oben drüber: Ihr müsst das System wieder zum Tanzen bringen.
von Billerbeck: Der Fernsehmacher Martin Wiebel war das über das Fernsehen nach 68 und wie es heute ist. Danke für das Gespräch, das wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet haben.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.