Von Natur aus Pessimist
In seinem Buch "Der Weg in den neuen Kalten Krieg" malt Peter Scholl-Latour ein düstere Bild von der Weltlage. Die Lage, die US-Präsident George W. Bush seinem Nachfolger hinterlasse, könne schlimmer nicht sein, die US-Außenpolitik sei rücksichtslos und das Land habe seinen Vorbildcharakter längst eingebüßt, warnt der Autor.
Heroischer Pessimismus ist das Markenzeichen des Peter Scholl-Latour. Der Mann ruht, wie kein zweiter, in sich selbst. Er zeigt alle Varianten von Gelassenheit, Altersweisheit, Ironie bis hin zu Zorn und Verachtung - und manchmal lacht er über die Ahnungslosigkeit der Politiker, wo es um die Gewaltnatur der Politik, die Antriebskräfte der Menschen und die Kraft der Geopolitik geht.
Heiß oder kalt - ein Drittes gibt es nicht im Denken des erfahrenen Welterklärers. Im Land der Träumer und Wolkenschieber ist er der Realist schlechthin, der weiß, wovon er spricht, der alles gesehen hat und der mit seinem Urteil nicht zurückhält, ob es um Russland geht, die Schluchten des Balkan oder die Minenfelder des Mittleren Ostens. Das macht ihn unbequem und zugleich populär, außer bei der Fachwissenschaft, die oftmals säuerlich den Mund verzieht.
Wenn man ihn liest, hört man ihn sprechen, sieht man ihn vor der Kamera. Das gilt auch für das jüngste Buch, eine Chronik der Jahre seit dem Weltereignis des 11. September 2001, als das World Trade Center zu Asche wurde und Amerika dem Terror den Krieg erklärte, der doch, bei Lichte besehen, nichts ist als die traditionell asymmetrische Kampfesweise des Schwachen gegen den Starken, dem neuerdings High-Tech-Bewaffnung eine Reichweite gibt wie nie zuvor.
Scholl-Latour hat diese Betrachtungen und Gespräche in der Zeitreihe geordnet, und er nennt die Jahre nach Chinesischer Zählung, vom Jahr der Schlange 2001 bis zum Jahr der Ratte 2008. Das Eindrucksvollste ist, dem Ganzen vorangestellt, ein Gespräch aus dem Frühjahr 2008. Es handelt von Tod und Leben und den Lehren der Geschichte. Auf die Frage, was das Positive sei am Alter, kommt die Antwort:
"Man empfindet doch eine größere Ausgeglichenheit. In der Jugend ist man stärker von Unruhe getrieben. Allerdings geht im Alter natürlich der erotische Pep abhanden. Das ist schon bedauerlich…"
Nächste Frage: Er sei bekannt gewesen als Peter Scholl-L’amour:
"Darum geht es nicht wirklich. (…) Ich habe nie nach Glück gestrebt, eher nach Ausgewogenheit. (…) Wirkliche, kurze Glücksmomente hat man sowieso nicht im Beruf, sondern wohl eher mit Frauen."
Ob er gelegentlich Charakterzüge an sich entdecke, die er lieber nicht kennen würde?
"Nee, ich habe die glückliche Gabe, Unschönes zu verdrängen. Ich erlaube mir auch gezielte Wutausbrüche."
Und wie er zum Alter stehe?
"In meiner Generation hat man das Thema nie diskutiert. Es war nach dem Krieg schon ein Privileg, überlebt zu haben."
Dann die Frage, ob er sich schon mal getäuscht habe, und die knappe Antwort:
"Da fällt mir nichts ein."
Und dann - was er weiter machen will?
"Ich werde weiter reisen, aber bin mir bewusst, dass die letzte große Reise nicht lange auf sich warten lässt."
Scholl-Latour hat der Versuchung widerstanden, nachträglich die Artikel und Gespräche zu korrigieren, die hier versammelt sind. Dem Leser bietet sich dadurch die Chance zu erkennen, wie oft Kassandra die Zukunft richtig erkannte. Scholl-Latour ist historisch hoch gebildet.
Aber was ihn noch mehr interessiert als die Vergangenheit, ist die Zukunft, die sich daraus zusammensetzen lässt. Kaum hatten die Amerikaner im Blitzkrieg des Herbst 2001 die Taleban besiegt, warnte Scholl-Latour vor Siegesfeiern:
"Da eine Einigung der Stammesführer, der Mullahs und deren Clans überaus fragwürdig bleibt, muss auch mit einem Bürgerkrieg gerechnet werden. Es sind allzu viele Blutfehden zu begleichen."
Die neue zentrale Front ist schon seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts der weitere Mittlere Osten, dem Scholl-Latour düstere Prognosen stellt. Aber die Kernthese seines Buches warnt vor dem neuen Kalten Krieg mit Russland. Der alte Kalte Krieg hatte feste Regeln und wurde überwölbt durch den nuklearen Frieden, der Rüstungskontrolle und feste Regeln umschloss. Die Supermächte traten einander nicht zu nahe, seitdem sie in Berlin- und Kubakrise vor fast 50 Jahren in den nuklearen Abgrund geschaut und darin ihren eigenen Untergang gesehen hatten.
Heute findet, so Scholl-Latours bittere Kritik, amerikanische Außenpolitik unter Absehung von der Landkarte Asiens und Europas statt, ohne Rücksicht auf die Interessen Russlands, und bewegt sich in immer gefährlichere Zonen, zuletzt mit dem Raketenschild in Polen und der Idee, Georgien und Ukraine in die NATO zu bringen.
Den meisten Europäern wird dabei Angst und Bange, und Scholl-Latour erklärt, warum. So schreibt er unter dem Datum des 25. August 2008, genau 15 Tage nach dem Krieg, den der georgische Führer vom Zaun gebrochen hatte und den die Russen durch Einmarsch beantworteten:
"Wer jetzt noch ernsthaft dafür plädiert, den Marsch nach Osten, der von Amerika geführt und von seinen europäischen Vasallen gefördert wird, weiter fortzusetzen, und wie Bundeskanzlerin Merkel sowohl den Georgiern wie den Ukrainern weiterhin Hoffnung auf Beitritt zur Allianz macht, ist sich der ungeheuerlichen Gefahr wohl nicht bewusst, die er damit heraufbeschwört."
Inzwischen haben Putin und seine Berater, wenn die USA so weitermachen, mit Krieg gedroht was immer das im Einzelnen zu bedeuten hätte - und die Bundeskanzlerin hat Festlegungen vermieden. Scholl-Latour beschreibt düstere Möglichkeiten:
"Man stelle sich vor, die Kaukasusrepublik Georgien sei am 9. August 2008 bereits vollgültiges Mitglied der NATO gewesen. Aufgrund der Unklarheit, die über den Ausbruch der Kämpfe (…) anfangs bestand, hätte Präsident Saakashvili sich auf Artikel Fünf des Nordatlantischen Vertrags berufen und militärischen Beistand seiner Verbündeten anfordern können"
Scholl-Latour beschreibt den neuen Kalten Krieg, der schon begonnen hat und in den die Europäer sich nicht hineinziehen lassen wollen. Vielleicht kehrt mit Obama wieder Staatsweisheit in Washington ein, vielleicht aber auch nicht. Tatsächlich ist die Lage noch ernster als Scholl-Latour sie beschreibt.
Denn der Kalte Krieg der Vergangenheit hatte feste Regeln, da gab es Sicherheitsabstände und einen unbegrenzten Respekt. Vor nuklearen Waffen, in einem Wort ein Gleichgewicht durch wechselseitig mögliche Zerstörung. Die Nuklearwaffen sind geblieben, die Regeln aber sind verloren gegangen, und nach dem langen nuklearen Frieden ist Krieg wieder denkbar
Wie Kassandra hat Scholl-Latour die Gabe, die Zukunft zu erahnen. Anders als im Fall Kassandra besteht indes die Hoffnung, dass seine Warnungen etwas nützen.
"Die Lage, die George W. Bush seinem Nachfolger hinterlässt, könnte schlimmer nicht sein (…). Im Innern wie nach außen setzt sich die Wahrnehmung durch, dass der Höhepunkt überschritten ist, das die USA den Vorbild-Charakter, an dem sich die übrige Welt ein halbes Jahrhundert lang orientierte, weitgehend eingebüßt haben."
Die Europäer sind gewarnt: Mit Amerika wird es schwierig, ohne Amerika noch schwieriger.
Peter Scholl-Latour: Der Weg in den neuen Kalten Krieg
Propyläen Verlag, Berlin 2008
Heiß oder kalt - ein Drittes gibt es nicht im Denken des erfahrenen Welterklärers. Im Land der Träumer und Wolkenschieber ist er der Realist schlechthin, der weiß, wovon er spricht, der alles gesehen hat und der mit seinem Urteil nicht zurückhält, ob es um Russland geht, die Schluchten des Balkan oder die Minenfelder des Mittleren Ostens. Das macht ihn unbequem und zugleich populär, außer bei der Fachwissenschaft, die oftmals säuerlich den Mund verzieht.
Wenn man ihn liest, hört man ihn sprechen, sieht man ihn vor der Kamera. Das gilt auch für das jüngste Buch, eine Chronik der Jahre seit dem Weltereignis des 11. September 2001, als das World Trade Center zu Asche wurde und Amerika dem Terror den Krieg erklärte, der doch, bei Lichte besehen, nichts ist als die traditionell asymmetrische Kampfesweise des Schwachen gegen den Starken, dem neuerdings High-Tech-Bewaffnung eine Reichweite gibt wie nie zuvor.
Scholl-Latour hat diese Betrachtungen und Gespräche in der Zeitreihe geordnet, und er nennt die Jahre nach Chinesischer Zählung, vom Jahr der Schlange 2001 bis zum Jahr der Ratte 2008. Das Eindrucksvollste ist, dem Ganzen vorangestellt, ein Gespräch aus dem Frühjahr 2008. Es handelt von Tod und Leben und den Lehren der Geschichte. Auf die Frage, was das Positive sei am Alter, kommt die Antwort:
"Man empfindet doch eine größere Ausgeglichenheit. In der Jugend ist man stärker von Unruhe getrieben. Allerdings geht im Alter natürlich der erotische Pep abhanden. Das ist schon bedauerlich…"
Nächste Frage: Er sei bekannt gewesen als Peter Scholl-L’amour:
"Darum geht es nicht wirklich. (…) Ich habe nie nach Glück gestrebt, eher nach Ausgewogenheit. (…) Wirkliche, kurze Glücksmomente hat man sowieso nicht im Beruf, sondern wohl eher mit Frauen."
Ob er gelegentlich Charakterzüge an sich entdecke, die er lieber nicht kennen würde?
"Nee, ich habe die glückliche Gabe, Unschönes zu verdrängen. Ich erlaube mir auch gezielte Wutausbrüche."
Und wie er zum Alter stehe?
"In meiner Generation hat man das Thema nie diskutiert. Es war nach dem Krieg schon ein Privileg, überlebt zu haben."
Dann die Frage, ob er sich schon mal getäuscht habe, und die knappe Antwort:
"Da fällt mir nichts ein."
Und dann - was er weiter machen will?
"Ich werde weiter reisen, aber bin mir bewusst, dass die letzte große Reise nicht lange auf sich warten lässt."
Scholl-Latour hat der Versuchung widerstanden, nachträglich die Artikel und Gespräche zu korrigieren, die hier versammelt sind. Dem Leser bietet sich dadurch die Chance zu erkennen, wie oft Kassandra die Zukunft richtig erkannte. Scholl-Latour ist historisch hoch gebildet.
Aber was ihn noch mehr interessiert als die Vergangenheit, ist die Zukunft, die sich daraus zusammensetzen lässt. Kaum hatten die Amerikaner im Blitzkrieg des Herbst 2001 die Taleban besiegt, warnte Scholl-Latour vor Siegesfeiern:
"Da eine Einigung der Stammesführer, der Mullahs und deren Clans überaus fragwürdig bleibt, muss auch mit einem Bürgerkrieg gerechnet werden. Es sind allzu viele Blutfehden zu begleichen."
Die neue zentrale Front ist schon seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts der weitere Mittlere Osten, dem Scholl-Latour düstere Prognosen stellt. Aber die Kernthese seines Buches warnt vor dem neuen Kalten Krieg mit Russland. Der alte Kalte Krieg hatte feste Regeln und wurde überwölbt durch den nuklearen Frieden, der Rüstungskontrolle und feste Regeln umschloss. Die Supermächte traten einander nicht zu nahe, seitdem sie in Berlin- und Kubakrise vor fast 50 Jahren in den nuklearen Abgrund geschaut und darin ihren eigenen Untergang gesehen hatten.
Heute findet, so Scholl-Latours bittere Kritik, amerikanische Außenpolitik unter Absehung von der Landkarte Asiens und Europas statt, ohne Rücksicht auf die Interessen Russlands, und bewegt sich in immer gefährlichere Zonen, zuletzt mit dem Raketenschild in Polen und der Idee, Georgien und Ukraine in die NATO zu bringen.
Den meisten Europäern wird dabei Angst und Bange, und Scholl-Latour erklärt, warum. So schreibt er unter dem Datum des 25. August 2008, genau 15 Tage nach dem Krieg, den der georgische Führer vom Zaun gebrochen hatte und den die Russen durch Einmarsch beantworteten:
"Wer jetzt noch ernsthaft dafür plädiert, den Marsch nach Osten, der von Amerika geführt und von seinen europäischen Vasallen gefördert wird, weiter fortzusetzen, und wie Bundeskanzlerin Merkel sowohl den Georgiern wie den Ukrainern weiterhin Hoffnung auf Beitritt zur Allianz macht, ist sich der ungeheuerlichen Gefahr wohl nicht bewusst, die er damit heraufbeschwört."
Inzwischen haben Putin und seine Berater, wenn die USA so weitermachen, mit Krieg gedroht was immer das im Einzelnen zu bedeuten hätte - und die Bundeskanzlerin hat Festlegungen vermieden. Scholl-Latour beschreibt düstere Möglichkeiten:
"Man stelle sich vor, die Kaukasusrepublik Georgien sei am 9. August 2008 bereits vollgültiges Mitglied der NATO gewesen. Aufgrund der Unklarheit, die über den Ausbruch der Kämpfe (…) anfangs bestand, hätte Präsident Saakashvili sich auf Artikel Fünf des Nordatlantischen Vertrags berufen und militärischen Beistand seiner Verbündeten anfordern können"
Scholl-Latour beschreibt den neuen Kalten Krieg, der schon begonnen hat und in den die Europäer sich nicht hineinziehen lassen wollen. Vielleicht kehrt mit Obama wieder Staatsweisheit in Washington ein, vielleicht aber auch nicht. Tatsächlich ist die Lage noch ernster als Scholl-Latour sie beschreibt.
Denn der Kalte Krieg der Vergangenheit hatte feste Regeln, da gab es Sicherheitsabstände und einen unbegrenzten Respekt. Vor nuklearen Waffen, in einem Wort ein Gleichgewicht durch wechselseitig mögliche Zerstörung. Die Nuklearwaffen sind geblieben, die Regeln aber sind verloren gegangen, und nach dem langen nuklearen Frieden ist Krieg wieder denkbar
Wie Kassandra hat Scholl-Latour die Gabe, die Zukunft zu erahnen. Anders als im Fall Kassandra besteht indes die Hoffnung, dass seine Warnungen etwas nützen.
"Die Lage, die George W. Bush seinem Nachfolger hinterlässt, könnte schlimmer nicht sein (…). Im Innern wie nach außen setzt sich die Wahrnehmung durch, dass der Höhepunkt überschritten ist, das die USA den Vorbild-Charakter, an dem sich die übrige Welt ein halbes Jahrhundert lang orientierte, weitgehend eingebüßt haben."
Die Europäer sind gewarnt: Mit Amerika wird es schwierig, ohne Amerika noch schwieriger.
Peter Scholl-Latour: Der Weg in den neuen Kalten Krieg
Propyläen Verlag, Berlin 2008
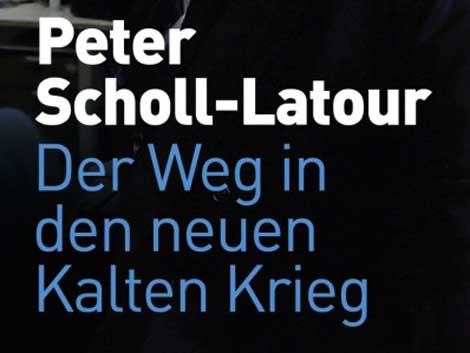
Peter Scholl-Latour: Der Weg in den neuen Kalten Krieg© Propyläen Verlag
