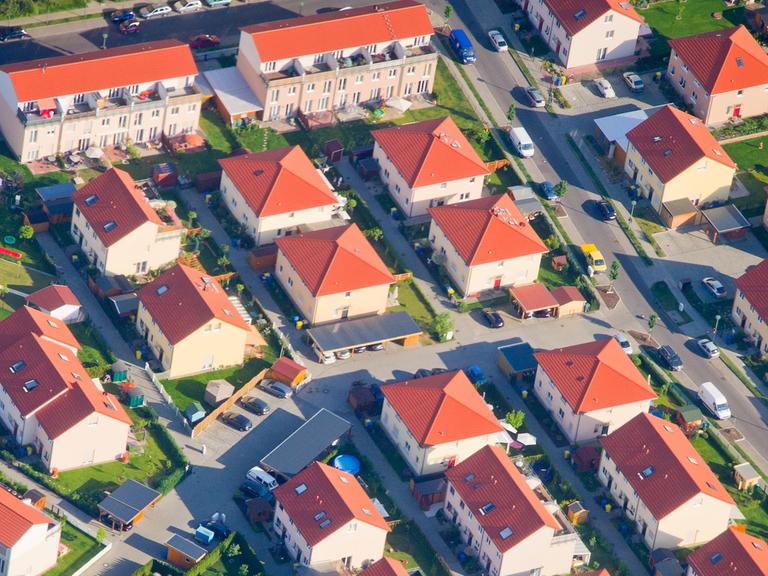Als Utopien und Lebensentwürfe geräumt wurden

Im Sommer 1990 schien im Osten von Berlin fast alles möglich. Etliche leerstehende Häuser wurden besetzt, es war Platz für alternative Lebensentwürfe, es wurde von einem "Dritten Weg" geträumt. Mit der Räumung der Mainzer Straße im November war für viele Schluss damit.
Das Haus in der Auguststraße 10 steht da wie ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Mitten im Scheunenviertel, im schicken Galeriebezirk Berlins sticht es, auf den ersten Blick völlig unrenoviert, zwischen den pittoresken Fassaden des Scheunenviertels, hervor. Eine Häuserwand mit Farbklecksen und bunten Fensterkreuzen, der Bröckelcharme der Neunziger.
Im ersten Stock: eine ganze Etage für die kleine Gemeinschaft, die hier lebt, 16 Künstlerinnen und Künstler, dazu vier Kinder. Küche, Gemeinschaftsräume, behutsam modernisiert, die Heizungen neu, die Bäder auch. Aber die Türen und die Böden sind alt. So soll das sein.
"Ich bin Steffi, Steffi Weismann, in der Schweiz aufgewachsen und 1988 nach Berlin gekommen, erst mal nach Westberlin und habe an der Hochschule der Künste studiert, und hab dann im Sommer 90 mit Freundinnen, Freunden, mit Studenten, dieses Haus hier in der Auguststraße 10 besetzt."
Inspiriert von Joseph Beuys, der das Leben und die Kunst zu einer Einheit verschmelzen wollte, entstand "Kunst und Leben" kurz KuLe. Im Sommer 1990, vor der Wiedervereinigung, gab es rund 100 besetzte Häuser in Ostberlin. Der Magistrat hatte dazu aufgerufen, leerstehenden Wohnraum "aktiv in Obhut zu nehmen" – und versprach, die Häuser irgendwann zu legalisieren.
Es gab rauschende Feste im Hof, lange Tafeln wurden auf der Auguststraße aufgebaut, neben dem Tacheles wurde die KuLe schon nach wenigen Wochen der Besetzung zu einem Magneten für Künstler und Besucher aus aller Welt.
Mitternächtliche Underground-Konzerte im Erdgeschoss, große Papierskulpturen auf dem Dach und an den Fassaden. Alles schien möglich.
Dennoch wollten die Künstler aus der KuLe bei all dem anders sein, als andere Hausbesetzer, eben kein Fremdkörper im Kiez. Heute gesteht Steffi Weismann selbstkritisch, dass das nicht immer gelungen ist.
"Also wir waren sehr präsent, wie wir uns so aufgeführt haben, das ganze Gehabe, wir wollten eigentlich nicht so mit so einer Besetzermentalität von West nach Ost kommen. Das war ja so dieses Übergriffige. Aber letztendlich haben wir das ein Stück weit unbewusst auch gemacht."
Die KuLe, als Initiative in der Hochschule der Künste entstanden, hatte gute Startbedingungen – das Establishment der noch geteilten Stadt sah sehr milde auf die besetzenden und das alte Haus ausbauenden Kunststudenten. Bis heute eine gern erzählte Anekdote am großen Küchentisch: Der Tag, als Heiner Müller kam, auch das im Sommer 1990.
"Da haben wir ihm einen Thron gebaut, haben ihm Whiskey und Zigarre besorgt",
Ursula Maria Berzborn, Besetzerin der ersten Stunde, Bühnen- und Kostümbildnerin, Theaterregisseurin.
"…und dann saß er da in der Ecke auf seinem Thron und dann hat er irgendwann gesagt: Leute, ihr seid physische Wesen. Ihr braucht ein Dach über dem Kopf. Haltet das Haus. Erzählt der Obrigkeit irgendwas, was die hören wollen, meinetwegen gründet einen ornithologischen Forschungsverein, aber versucht, dieses Haus zu halten."
Zur Kunst des Zusammenlebens gehört erstens die Bereitschaft, Streitfragen bis zu einem gemeinsamen Konsens, mit dem alle leben können, auszudiskutieren. Und zweitens, das "Spannungsfeld von Ego und Gruppe" auszuhalten – wenn möglich zugunsten der Gruppe. Man bringt sich ein, so gut es geht – und zwar freiwillig.
"Bei uns gibt es keine strikte Kochplan-Organisation. Es geht halt immer darum, dass man verantwortlich ist für das Ganze, aber dass man trotzdem die Freiheit, die man als Künstler braucht, haben darf."
Die Küche ist vielleicht der wichtigste Raum in der KuLe. Hier entsteht das eigentliche Kunsthaus: im Gespräch, im Miteinander, über Kochtöpfen und am Essenstisch, beim Abwasch.
"Es gibt hier bis heute in der Küche Situationen, wo Leute sich über bestimmte künstlerische Dinge austauschen, da gibt’s Beeinflussungen, aber es gab natürlich auch Projekte, wo man richtig zusammen gearbeitet hat und das dann zusammen realisiert."
Der Ausnahmesommer 1990
So haben sich über Jahrzehnte Künstler gefunden und Pläne geschmiedet, gemeinsame Projekte ausgeheckt, sich gegenseitig auf Ideen gegeben, und weil die Belegschaft oft wechselte – bis heute tut sie das – entstanden Verbindungen unter Theaterleuten, Malern, Bildhauern, Musikern, und Filmern. Im Sommer feierte die KuLe 25-Jähriges Bestehen – und erinnerte sich an den Ausnahmesommer 1990, als in der verschwindenden DDR so vieles möglich war. Steffi Weismann:
"Die Volkspolizisten waren nicht mehr zuständig, die kamen dann mal her und haben so ein bisschen geguckt, und wir hatten gleich Angst, die räumen uns, oder so, aber die hatten gar nicht Befugnis, sowas zu machen. Das war schon eine sehr verrückte Zeit. Und das ist ja dann irgendwann gekippt, mit der Räumung der Mainzer Straße."
"Die Volkspolizisten waren nicht mehr zuständig, die kamen dann mal her und haben so ein bisschen geguckt, und wir hatten gleich Angst, die räumen uns, oder so, aber die hatten gar nicht Befugnis, sowas zu machen. Das war schon eine sehr verrückte Zeit. Und das ist ja dann irgendwann gekippt, mit der Räumung der Mainzer Straße."
Denn der Besetzersommer 1990 endete am 12. November. Es begann mit der Räumung eines kleineren besetzten Hauses in der Lichtenberger Pfarrstraße durch die Polizei – und geriet noch am gleichen Vormittag zu einer Straßenschlacht. Drei Tage lang verschanzten sich daraufhin Hunderte von Unterstützern in der Mainzer Straße im Bezirk Friedrichshain, wo ein ganzer Häuserblock besetzt war.
Bandreportage 1990: "Vor Ort hier in der Mainzer Straße: Ich bin über Tausende von losen Pflastersteinen gestiegen, vorbei an umgeworfenen Bauwagen mit der Aufschrift ´Bullen, verpisst euch`, über aufgerissene Straßenlöcher. Aber das ist es wohl nicht allein, nicht dieser Dreck, nicht dieser Schutt, vielleicht nicht einmal die Gegenwart der vielen Hundertschaften der Polizei, diese düsteren grauschwarzen Häuserfassaden, die zerbrochenen Fenster und die schmutzig weißen Transparente in dieser trostlosen Gegend sind es, die die gesamte Situation hier unheimlich erscheinen lassen."
Bandreportage 1990: "Vor Ort hier in der Mainzer Straße: Ich bin über Tausende von losen Pflastersteinen gestiegen, vorbei an umgeworfenen Bauwagen mit der Aufschrift ´Bullen, verpisst euch`, über aufgerissene Straßenlöcher. Aber das ist es wohl nicht allein, nicht dieser Dreck, nicht dieser Schutt, vielleicht nicht einmal die Gegenwart der vielen Hundertschaften der Polizei, diese düsteren grauschwarzen Häuserfassaden, die zerbrochenen Fenster und die schmutzig weißen Transparente in dieser trostlosen Gegend sind es, die die gesamte Situation hier unheimlich erscheinen lassen."
Nach drei Tagen Belagerung wurde geräumt. Die Besetzer wehrten sich, teils heftig. Aus dem Inneren eines Polizeieinsatzwagens:
Durchsage für den Polizeifunk: "Straftäter flüchten. Barrikadenbau in den Straßen. (Steine prasseln aufs Wagendach) Steinwürfe von den Dächern. Massive Steinwürfe, massive Steinwürfe aus der Mainzer Straße, Straftäter vermummt…"
"Um halb zwölf hat die Polizei ohne weitere Vorwarnung einen Räumpanzer hier durchgeschickt. Und hinter dem Räumpanzer kam der Wasserwerfer und hat wahllos auf die besetzten Häuser aber auch auf die gegenüberliegenden Häuser Gas- und Wassereinsätze gefahren."
"Wir sind noch nach Friedrichshain reingekommen, was ein paar Stunden später ja auch nicht mehr ging, aber wir sind halt nicht mehr in die Mainzer Straße reingekommen. Und standen dann halt draußen in den Ketten, die dann halt gerufen haben und das war ein richtig krasser Einschnitt nach diesem Sommer der Anarchie, wo man einfach das Gefühl hatte, es ist alles möglich, uns gehört die Stadt und natürlich auch politisch, es wurde ja gesprochen über den Dritten Weg, also es gab halt so eine Utopie, dass was anderes jetzt auch von irgendeiner Art von Staatsstruktur entstehen könnte und das war einfach mit diesem Tag dann komplett klar, dass das nicht so funktioniert."

Räumung in der Mainzer Straße im November 1990 © picture alliance / dpa / Foto: Thomas Lehmann
Für die meisten übrig gebliebenen besetzten Häuser in Berlin hieß das: Verhandlungen, irgendwann Mietverträge, bei manchen Häusern die Sanierung. Die Besonderheit in der Auguststraße: Die Spuren der Vergangenheit sind erhalten worden. Ursula Maria Berzborn.
"Unser Anliegen war, diesen Mittelteil als Denkmal zu erhalten, mit den Einschusslöchern, Granatensplittern aus dem Zweiten Weltkrieg und das Erdgeschoss haben wir ganz am Anfang dunkelblau silbrig angestrichen, das Konzept war eben, dass es temporär, immer wieder veränderbar angemalt, angespritzt, betaggt, begraffitit wird, als Erinnerung an die Neunziger."
Linienstraße 206
Ein paar Häuser weiter, das ehemals besetzte Haus in der Linienstraße 206. Auch hier: Grauer Putz auf unrenovierter Fassade, Parolen, Transparente. Anders aber als in der Auguststraße ist das angekratzte Äußere echt. Das Haus steht da wie ein Denkmal – und ist zur Attraktion geworden. Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich bisweilen wie im Zoo.
"Ich versteh das total, dass man hinguckt, wenn ich woanders wär, würd ich das auch tun und denken, oh, cool, und dass man dann Transpis fotografiert, dafür sind sie eigentlich gemalt. Es gibt aber auch Leute, die respektloser sind, die so an einem vorbei fotografieren wollen, oder Vögel, die dann ins Haus wollen. Wir machen keine Touristenführungen durchs Haus. Das wäre vielleicht nochmal wichtig für die Öffentlichkeit."
"Ich versteh das total, dass man hinguckt, wenn ich woanders wär, würd ich das auch tun und denken, oh, cool, und dass man dann Transpis fotografiert, dafür sind sie eigentlich gemalt. Es gibt aber auch Leute, die respektloser sind, die so an einem vorbei fotografieren wollen, oder Vögel, die dann ins Haus wollen. Wir machen keine Touristenführungen durchs Haus. Das wäre vielleicht nochmal wichtig für die Öffentlichkeit."
Elisa und Julius, beide um die 30. Für sie sind die alten Geschichten aus der Mainzer Straße weit weg. Nicht nur witzig finden sie, dass es heute Nachbarn gibt, die von der kaputten Fassade auf die Bewohner schließen und Lebensmittel vor die Tür stellen.
"Es ist ein anderer Lebensentwurf. Wir leben hier nicht aus Armut. Ich glaub, das ist teilweise auch ein Missverständnis, natürlich ist es in Ordnung, Essen was übrig ist, an Menschen, wo viele zusammenleben, abzugeben, aber es fühlt sich manchmal etwas komisch an, wenn man mitleidig angeguckt wird, wenn man hier aufschließt."
Auch hier gilt das Gemeinschaftsprinzip, es gibt keine Essenskasse, jeder bringt ein, was er hat – eigenverantwortlich. Und es wird viel diskutiert, Konflikte kommen so lange auf den Tisch, bis die Lösung für alle gefunden ist.
"Das kann sehr, sehr anstrengend sein, aber es ist eben letzten Endes einer der besten Wege, die ich kenne, wie man einen Umgang miteinander findet, wo alle zufrieden sind am Ende miteinander."
"Das kann sehr, sehr anstrengend sein, aber es ist eben letzten Endes einer der besten Wege, die ich kenne, wie man einen Umgang miteinander findet, wo alle zufrieden sind am Ende miteinander."
Das Haus in der Linienstraße gilt als vergleichsweise undogmatisch. Verschiedene Strömungen der Linken leben hier friedlich unter einem Dach. Ein Zeichen der Toleranz: Es gibt drei Küchen – aus gutem Grund.
"Wir haben halt auch unsere Fleischfresser und es gibt halt auch Veganer oder Vegetarier, die kein Bock haben, in eine Küche zu kommen und dann steht da totes Schwein und die Pfanne riecht auch so…"

Demonstration für den Erhalt des Wohnprojektes "Linie 206" im April 2013 in der Berliner Linienstraße. © picture alliance / dpa / Foto: Britta Pedersen
Das Politische des Wohnens in der Linienstraße 206 besteht aber auch aus Nachbarschaftsarbeit in der Gegend rund um den Rosenthaler Platz, die sich stark verändert hat: Die Bevölkerung ist seit 1990 mehrfach ausgetauscht worden, heute ist der Kiez beliebt bei internationalen Millionären, die Wohnungen kaufen, um ein paar Wochen im Jahr dort zu sein – meist stehen sie leer. Wenn die Bewohner der Linienstraße sich also für einen Nachbarschaftsgarten einsetzen oder dafür, dass ein kleiner Mini-Markt nicht gekündigt wird, dann kämpfen sie für eine lebendige Innenstadt, mit Menschen, die sie bewohnen. Radikal ist das nicht.
Andere ehemalige Hausbesetzer dagegen haben es sich mit den Jahren bequem gemacht. Das jedenfalls ist die Kritik von Stadtsoziologen, die sich wissenschaftlich mit den Wirkungen besetzter Häuser auf ihre Umgebung beschäftigen. Nachdem an runden Tischen mit Behörden und Eigentümern verhandelt wurde und Mietverträge unterzeichnet worden sind, die auf Dauer günstige Mieten garantierten, hatten viele ehemals besetzte Häuser gerade in Ostberlin der Gentrifizierung ihrer Nachbarschaften nichts mehr entgegenzusetzen, sagt der Berliner Stadtforscher Armin Kuhn.
"Die besetzten Häuser, oder eigentlich die dann legalisierten Häuser waren eigentlich so eine Art isolierte Fremdkörper in ihren Stadtteilen. Während ihre Nachbarinnen und Nachbarn zu diesem Zeitpunkt erst angefangen haben zu begreifen, was es bedeutet, in der Wiedervereinigten Stadt zu leben, nämlich die Durchsetzung von Privatinteressen der Eigentümer in ihren Häusern, und davor waren die Besetzerinnen und Besetzer relativ verschont gewesen, was dann ein Erklärungsfaktor auch dafür ist, dass die besetzten Häuser in den beginnenden Nachbarschaftsprotesten kaum eine Rolle gespielt haben."
Bald wurden demnach nur noch Türrahmen gestrichen und Feste ausgerichtet. Die eigenen Pfründen waren sicher, man ruhte sich auf den Lorbeeren aus und leckte die Wunden aus verlorenen Schlachten. Soweit die Vorwürfe.
"Allerding ist die Mainzer Straße für die städtischen Bewegungen auch ein Trauma. Sich so zur Wehr gesetzt zu haben und eine militärische Niederlage eingefahren zu haben, mit sehr vielen Verletzten, man kann ja fast von einem Wunder sprechen, dass es keine Toten gegeben hat in der Mainzer Straße."
Kastanienallee 77
"Hallo! / Hallo! / Ich bin Andreas. / Ich bin Carola. / Schön, dass du Zeit hast . / Ja, willst du einen kurzen Eindruck haben? / Ja. Wahnsinnig gern."
Carola Grimm, ehemals Besetzerin, heute legale Bewohnerin des Hauses in der Kastanienallee 77 – auch dies von außen eine Postkarte aus den 90ern. Innen: große Räume, Bäder, moderne Heizungen, Wände in Lehmbauweise, eine große Küche und Gemeinschaftsräume, eine Bibliothek.
"Die 77, vielleicht bedeutet die mir auch deswegen so viel. Weil das eine Art Happy End war."
Denn die Gruppe, die 1992 das Haus, das eine Ruine war, besetzte, hatte sich als Reaktion auf die Räumung der Mainzer Straße gegründet. Man wollte die harte Berliner Linie, mit der der Senat jedes Haus innerhalb von 24 Stunden kompromisslos räumte, durchbrechen – das gelang, indem die Besetzung zur Kunstaktion erklärt wurde – und friedlich blieb.
Carola Grimm betreibt eine Keramik-Werkstatt im Hinterhof. An manchen Tagen fragen sie mehrere Passanten ganz direkt, wo man sich melden muss, um das Haus zu kaufen. Die Kastanienallee hat sich, mehr noch als andere Straßen im Viertel, verändert, die Immobilien in der Straße sind längst verkauft und aufwändig aufgewertet. Früher, sagt Carola Grimm, haben hier die Menschen auf der Straße gefrühstückt. Heute ist das nicht mehr erlaubt. Wer das tut, braucht die Lizenz, ein Café zu betreiben. Erst kamen die Künstler, dann die Prominenten, dann, auch hier, die Millionäre.
"Ich weiß gar nicht, warum die Leute hier sind. Aber die wollen hier sein und finden das auch gut hier. Aber die lassen es ja nicht das sein, was es ist. Obwohl sie ihre Kinder auch gerne in diese tollen Kindergärten und Schulen schicken, die wir gegründet haben."
Stadtforscher Armin Kuhn hält das allerdings für ein Vorurteil. Weder haben die besetzten Häuser, wie er in einer wissenschaftlichen Arbeit darlegen konnte, eine Pionierrolle für die Aufwertung der Stadtviertel gehabt. Noch waren sie ein Störfaktor für die Verwandlung der Arbeiterbezirke in Edelkietze.
"Das Eigentümliche an der Besetzungsbewegung der 90er-Jahre war eben, dass sie zu einem Zeitpunkt aufgetreten sind, als die Weichen für ein ganz bestimmtes Stadtentwicklungsmodell, nämlich eins was auf Privatinvestoren und Profitmaximierung setzt, schon gestellt war und die in einer Weise und einer Mächtigkeit schon gestellt waren, dass die Hausbesetzungsbewegungen dagegen eigentlich kaum vorgehen konnten."
Dennoch waren die Besetzungen wirksamer als jede politische Initiative zur Mietenkappung, sagt Armin Kuhn. Wer in ehemals besetzten Häusern wohnt, zahlt weniger Miete, kann völlig anders leben als seine Nachbarn und gibt schon deshalb ein sichtbares Zeichen dafür, dass es Alternativen gibt.
"Das hier war keine Spielerei für junge Erwachsene, sondern wir leben hier mit unseren Familien. Und wir sind immer noch nicht interessiert, diesen Konsumrausch als was ganz Wichtiges für uns zu empfinden."
Wer übrigens glaubt, dass Hausbesetzungen in Berlin der Vergangenheit angehören, der irrt sich Armin Kuhn und Carola Grimm zufolge gewaltig. Nur sehen die anders aus als vor 25 Jahren. Noch im vergangenen Jahr wurde im Wedding die Besetzung einer Eisfabrik beendet, in Kreuzberg die eines brachliegenden Grundstücks – und neuerdings planen gar Gruppen von Senioren, sich die Räume für ihre Alters-WGs kurzerhand durch Besetzungen zu besorgen – ob der Senat gegen sie wirklich so hart durchgreifen wird, wie es die Berliner Linie verlangt?
"Hausbesetzungen gibt es. Aber ganz anders. Versteckt. Eben nicht mehr als dieses massive Mittel einer städtischen Bewegung. Wobei da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen ist."
"Also ich kenne ganz viele Gruppen die über solche Besetzungen sprechen. Die da interessiert sind. Die auf den richtigen Moment warten."