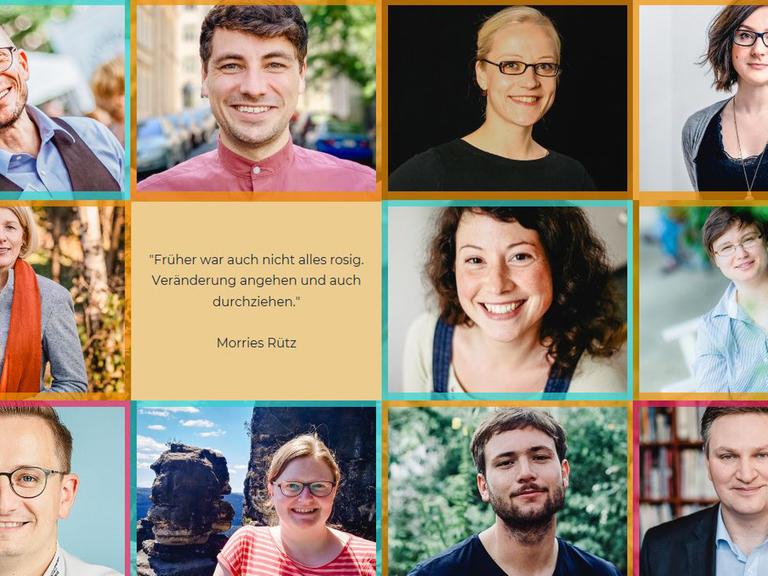Medien über Ostdeutschland: 50 Shades of Grey
16:11 Minuten

Vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Bis heute scheint das Land jedoch gespalten zu sein – auch, weil Medien die alten Klischees befeuern. Warum?
Wenn in den Medien über die Bundesländer der ehemaligen DDR berichten, ist es oft von Klischees geprägt. Die Bilder sind grau, die Menschen sind grau, die Perspektive ist grau. Dabei ist die Mauer vor 30 Jahren gefallen. Trotzdem haben bis heute alle ein Bild vor Augen, wenn es um "den Osten" geht. Ein Stereotyp, das für "den Westen" nicht existiert.
Warum ist das so? Um das zu klären, haben wir Valerie Schönian, Journalistin und Autorin des 2020 erscheinenden Buches "Ostbewusstsein: Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet" und dem Soziologen Thomas Ahbe, Co-Autor des Buches "Die Ostdeutschen in den Medien. Das Bild von den Anderen nach 1990" eingeladen.
Safari-Journalismus in Ostdeutschland
Für Schönian tragen die Medien einen Anteil daran, dass viele Klischees über Ostdeutsche in den Köpfen wirken. Alleine "Ostdeutschland" als Thema zu machen, sei schon Teil des Problems, schließlich würde nie in vergleichbarer Weise über "Westdeutschland" gesprochen. Doch sobald etwas in den neuen Bundesländern vorfalle, wäre wieder von "Ostdeutschland" die Rede, als sei es ein anderes Deutschland.
Schönian sieht in Angeboten wie der Ostbeilage in der ZEIT einen wichtigen Zwischenschritt. Denn in Hamburg habe man erkannt, dass es wichtig sei, Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort zu haben, die auch Menschen in der Gegend kennen. Die sei auch ein wichtiges Signal an Ostdeutsche, die sonst nur Ziel von Safari-Journalismus, wie Schönian ihn nennt, seien, wo 50 Journalistinnen und Journalisten in die Stadt kämen, wenn irgendwas passiert, und dann wieder verschwinden.
Doch es sei eben nur ein Zwischenschritt. Das Ziel müsse sein, eine gewisse Selbstverständlichkeit zu erreichen, in der man sich nicht mehr aktiv um den Osten bemühen müsste, weil Ostdeutsche wie selbstverständlich feste Mitglieder in Redaktionen seien und so ihre Perspektive einbrächten.
Denn momentan sei es so, dass sie in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen durchaus einen anderen Blick auf Dinge bemerkt, gerade weil diese nicht vor Ort bewegen. Es sei eben wichtig, die Leute zu kennen, deren Meinungen zu hören, all das seien Kompetenzen, die es eben bräuchte, wenn man über den Osten schreibt.
Sippenhaft gibt es nur im Osten
Eine Veränderung ist auch für Thomas Ahbe sehr wichtig. Denn er konnte seit der Wende noch keine Veränderung in der Berichterstattung über Ostdeutschland feststellen. Der NSU, die ausländerfeindlichen Exzesse und die Unruhen in Chemnitz seien immer als Problem des Ostens und nie als Einzelphänomen begriffen worden.
Ähnliches sei aber nicht zu beobachten gewesen, als der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen oder Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker angegriffen wurde. Es sei also definitiv ein Unterschied zu beobachten. Darum gelte es zu fragen, warum das passiere.
Ahbe sieht in der deutschen Medienlandschaft ein strukturelles Problem, das dazu führe. Denn diese würde von zentralen, westdeutschen Akteuren bespielt – von Print bis TV. Selbst ostdeutsche Lokalzeitungen seien nicht in ostdeutscher Hand und eine mittelständisch geprägte Lokalpresse existiere im Osten nicht. Das bedeute natürlich nicht, dass die Besitzverhältnisse zwangsläufig zu einer negativen Berichterstattung führen, jedoch zeige es gut, wie so etwas möglich sei.
Außerdem werde immer erwartet, dass der Osten sich an den Westen anpassen muss, sagt Ahbe. Dabei könne man auch im Westen mal über seine Prägungen nachdenken. Deshalb sieht er es auch wie Valerie Schönian: Es müsse zur Norm werden, dass Ostdeutsche in Redaktionen zum Standard werden.
(hte)