Wagners Meisterstück
Kein Werk Richard Wagners ist so eng mit den Bayreuther Festspielen - mit der Idee wie mit der Ideologie - verbunden wie der "Parsifal".
Ausgehend von der zentralen Maxime des Musik-Dramatikers, dass ein "Kunstwerk nur durch das Theater in das Leben" trete, setzt sich Stephan Mösch in seiner Studie "Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit – Parsifal in Bayreuth 1882 – 1933" zum einen mit der Uraufführung, den Problemen der Musik, der Sprache und des Singens wie der szenischen Darstellung auseinander, zum anderen mit der Rezeptions- und der Wirkungsgeschichte, also dem gesamten Ideenkomplex. Dieser lässt sich unter einem Titel zusammenfassen: "Wagner und sein Parsifal im Lichte unserer Erfahrung."
Das Buch, ist in der Verbindung von Musikwissenschaft und Theatergeschichte, Ideen-, Kultur- und politischer Geschichte ein Novum. Ausgangspunkt ist das Faktum, dass Wagners Weltabschiedswerk ein sich perpetuiertendes "konnektives Ritual" herstellte. Dass die Inszenierung der Uraufführung fünf Jahrzehnte lang gezeigt wurde, setzte eine religiös gestimmte Gemeinde voraus, die eine Messe feierte und nichts anderes sehen wollte als das, "worauf die Augen des Meisters geruht" hatten.
Umso ernüchternder Möschs akribische Schilderung der alltäglich-schwierigen Vorbereitungen für die Uraufführung anno 1882. Bei der Einstudierung ging es Wagner zunächst darum, so Mösch,
"die Partitur samt Szenenanweisung durch Decodierung verfügbar zu machen und Stilbewusstsein als Werkbewusstsein zu etablieren. ... Bei diesem Prozess begriff Wagner die Materialität des ausführenden Apparats als Teil seines Stücks."
Im dritten Kapitel beschreibt Mösch die Uraufführung als erfolgreiches Scheitern. Noch einmal: als erfolgreiches Scheitern. Mösch hat etliche neue Quellen erschlossen – darunter Tagebucheintragungen des Komponisten Wilhelm Kienzl oder Briefe der Sängerin Marianne Brandt –, aus denen hervorgeht, wie unsicher und ungeschickt der Regisseur Wagner im Umgang mit seinen Darstellern war. Seine Intentionen gab er oftmals als Befunde aus. Das Kernproblem, dem sich Wagner gegenüber sah, lag in der "Synchronisation von Klangidee und Szene". Darin also, dass sich seine szenischen Ideen, die in die Musik und ihre Gestik selber eingesenkt waren, nicht oder nur schwer in einen konkrete szenische Realität überführen ließen. Schon 1878 hatte er gegenüber Cosima die Idee eines imaginären Theaters entwickelt:
"Ach! Wie graut mir vor allem Kostüm- und Schminkewesen! Wenn ich daran denke, dass diese Gestalten wie Kundry nun sollen gemummt werden, fallen mir gleich die ekelhaften Künstlerfeste ein, und nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden!"
Mit Blick auf die Uraufführung des "Parsifal" folgert Mösch:
"Wagner war, überspitzt gesagt, der erste Regisseur, der an Wagner, dem Musikdramatiker scheiterte."
Insofern bedeutet die fünf Jahrzehnte währende Bewahrung – 'Parsifal' als konserviertes Theater – den vollendeten Verrat an den Intentionen des Komponisten – an seine Forderung: "Schafft Neues, Kinder, schafft Neues!"
Das faszinierende vierte Kapitel ist "aufführungspraktischen Strategien" gewidmet mit erhellenden Ausführungen über die "unsichtbare Seele" des Werks – den neuartigen Orchesterklang. Rückschlüsse auf die musikalische Einrichtung der Uraufführung geben diverse Klavierauszüge von Anton Rubinstein mit Eintragungen von Wagners Mitarbeiter Heinrich Porges, des Bayreuther Studienleiters Julius Kniese, von Cosima und Franz Beidler; die dreibändige Dirigierpartitur; ein Sänger-Auszug der Kundry-Partie aus dem Besitz von Marianne Brandt; endlich jene Zettel, auf denen Cosima während der Proben in einem für sie eingerichteten Verschlag Beobachtungen und Anweisungen für die Künstler notierte. Den musikalischen Details der insgesamt zehn Quellen – sie betreffen Fragen der Vortragsanweisungen, der Deklamation wie der des Ausdrucks, der Tempi und ihrer Modifikationen – dieser "regiebestimmenden Wirkung der Musik" also widmet Mösch ausführliche Struktur-Analysen. Zu diesen aufführungstechnischen Fragen hat er überdies nicht allein die neuere Forschungsliteratur konsultiert – die Studien von Egon Voss, Martin Geck, Gerd Rienäcker und Jürgen Maehder - , sondern auch mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, James Levine und Hartmut Haenchen sowie Orchestermusikern.
Auf der zweiten Ebene seiner Darstellung erfüllt Mösch eine Forderung von Joachim Fest: "Um einen Wagner von außen bittend." Er verfolgt das quälende Zusammenspiel von Ästhetik, Kunst und Religion, das zunächst die Grundlagen für den Bayreuther Parsifal-Kult schuf, dessen universaler Anspruch – das Evangelium des Grals – dem ideologischen Missbrauch Tür und Tor öffnete. Er legt dar, wie das Werk, sein Auftrag und seine Wirkung sukzessive – und nicht selten auf widersprüchliche Weise – mit ideologischen Phantasmagorien angereichert wurden. Etwa dergestalt, dass, wie Mösch über einen geistigen Untermieter in der Ideenwelt Wagners schreibt,
"die Vorstellung des Allgemein- oder Rein-Menschlichen, die bereits bei Wagner zum kulturreligiösen Missionsgedanken tendiert, völkisch überformt wird. Nationales und Universales sind dabei insofern verschränkt, als eine spezifisch deutsche Disposition zur Verwirklichung des Rein-Menschlichen angenommen wird, die auf Kulturimperialismus hinausläuft."
Wagners Träume von der "deutschen Selbstveredelung" finden ihre politische Entsprechung in grauenerregenden antisemitischen Atrozitäten sowohl des Komponisten als auch des intellektuellen Lumpenpacks, das den "Parsifal" in den Dienst deutsch-nationaler und dann antisemitischer Ideologie stellte. Mösch ist weit davon entfernt, wohlbekannte alte Vorwürfe, den Antisemitismus Wagners betreffend, zu wiederholen. Antisemitismus sei, wie Mösch betont, nicht als "Werkauftrag" in den "Parsifal" eingeschrieben. Aber gerade dieses Werk sorgte, gleichsam als Ideen-Souffleur, dafür, dass die Festspiele zu einem "Kult" wurden – und zur Quelle deutsch-nationaler Ideologie mit ihrer Erlösungsfaselei. Mösch konkretisiert dies zum einen durch die Äußerungen von Wagners klugen Affen wie Houston Stewart Chamberlain, zum anderen an einem Einzelschicksal: "Parsifal als Selbstversuch: Hermann Levi."
Es ist die Geschichte des Uraufführungsdirigenten, dem Cosima mit raffiniert sublimierten Sadismus das Verhängnis seiner "Race" deutlich zu machen nicht müde wurde: das den Juden selber von Wagner in seiner schändlichen Schrift "Das Judenthum in der Musik" aufgedrückte Stigma: das der "Kulturunfähigkeit".
"Was Wagner versuchte, verfolgte seine Witwe hartnäckig weiter: Levi als Exempel zu statuieren, bei dem christlicher Geist das Judentum auflösen, nämlich zur Selbstauflösung motivieren könne. Sobald es um die Aufführungspraxis ging, war Qualität keine Sache kapellmeisterlicher Tugenden mehr, sondern eine von Glauben und Glaubensfähigkeit, somit nach den gepflegten Denkrastern einer der Rasse."
Cosima bezeichnete den Dirigenten als Talent, das sich "aus eigener Kraft" am "Genie emporrankte". Seine Konflikte deutete sie als Folge eines seinem Stamme mitgegebenen Fluches:
"Mangel an Glauben, selbst da, wo er Überzeugung hatte, Mangel an Andacht sogar da, wo er verehrte."
Bei seinen Dirigaten, so hielt sie Hermann Levi mit einer Art von sadistischer Seelsorge vor, seien "Glaubensdefizite" spürbar. Und wenn ihr Sohn Siegfried den Dirigenten als Kundry-Natur bezeichnete, wird erkennbar, in welchem Sinne das Werk ideologisch vereinnahmt wurde.
"Die Vorstellung, dass eine primär heidnische, schuldhaft und darin (nicht nur, aber auch) jüdisch konnotierte Symbolfigur es selbst nach der Konvertierung nicht aushält, mit dem ,Schrecken der Heiligkeit‘ konfrontiert zu werden, spricht für eine antisemitisch kontaminierte Erlösungsidee. Diese Idee war anschlussfähig für den mit dem Parsifal geführten Kulturkampf."
Dass es Cosima, von Wagner nicht für die Nachfolge in Bayreuth vorgesehen, gelang, die Festspiele zu etablieren, ist unbestreitbar. Sie hat dies zum einen mit den Mitteln einer "ins Pathetische gesteigerten Witwenschaft" getan,
- zum zweiten im Sinne eines dynastischen Systems,
- zum dritten aber mittels der Überformung der Festspiele durch einen identitätsstiftenden Mythos,
- zum vierten durch ideologische Anpassung, die den faschistischen Massenfang ermöglichte.
Wenn aber nach dem Tod einer charismatischen Gründerfigur die Legitimation kriselt, hilft der Weg nur noch über das Dogma. Ein Bilanz:
"Gesinnung, Gemeindebildung und Gefolgschaft gehören nun in Bayreuth zusammen. Religiöses, regeneratorisches, nationalistisches und rassentheoretisches Verantwortungsbewusstsein ließen sich im Zeichen des Grals mühelos zusammenschweißen."
Wer die Geschichte des Komponisten und die seiner Familie von 1876 bis zur Gegenwart erforscht, so schrieb Hans Mayer vor drei Jahrzehnten in seinem Wagner-Buch "Mitwelt und Nachwelt", schreibt zugleich deutsche Geschichte und Weltgeschichte. Möschs Studie macht einmal mehr und auf schmerzliche Weise deutlich, dass die Geschichte Wagners wie die Wirkungsgeschichte seines Werks nicht abgegolten sind und für jede Generation neu geschrieben werden müssen.
Stephan Mösch: Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit - Wagners "Parsifal" in Bayreuth (1882-1933)
Verlag Bärenreiter-Metzler
Das Buch, ist in der Verbindung von Musikwissenschaft und Theatergeschichte, Ideen-, Kultur- und politischer Geschichte ein Novum. Ausgangspunkt ist das Faktum, dass Wagners Weltabschiedswerk ein sich perpetuiertendes "konnektives Ritual" herstellte. Dass die Inszenierung der Uraufführung fünf Jahrzehnte lang gezeigt wurde, setzte eine religiös gestimmte Gemeinde voraus, die eine Messe feierte und nichts anderes sehen wollte als das, "worauf die Augen des Meisters geruht" hatten.
Umso ernüchternder Möschs akribische Schilderung der alltäglich-schwierigen Vorbereitungen für die Uraufführung anno 1882. Bei der Einstudierung ging es Wagner zunächst darum, so Mösch,
"die Partitur samt Szenenanweisung durch Decodierung verfügbar zu machen und Stilbewusstsein als Werkbewusstsein zu etablieren. ... Bei diesem Prozess begriff Wagner die Materialität des ausführenden Apparats als Teil seines Stücks."
Im dritten Kapitel beschreibt Mösch die Uraufführung als erfolgreiches Scheitern. Noch einmal: als erfolgreiches Scheitern. Mösch hat etliche neue Quellen erschlossen – darunter Tagebucheintragungen des Komponisten Wilhelm Kienzl oder Briefe der Sängerin Marianne Brandt –, aus denen hervorgeht, wie unsicher und ungeschickt der Regisseur Wagner im Umgang mit seinen Darstellern war. Seine Intentionen gab er oftmals als Befunde aus. Das Kernproblem, dem sich Wagner gegenüber sah, lag in der "Synchronisation von Klangidee und Szene". Darin also, dass sich seine szenischen Ideen, die in die Musik und ihre Gestik selber eingesenkt waren, nicht oder nur schwer in einen konkrete szenische Realität überführen ließen. Schon 1878 hatte er gegenüber Cosima die Idee eines imaginären Theaters entwickelt:
"Ach! Wie graut mir vor allem Kostüm- und Schminkewesen! Wenn ich daran denke, dass diese Gestalten wie Kundry nun sollen gemummt werden, fallen mir gleich die ekelhaften Künstlerfeste ein, und nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden!"
Mit Blick auf die Uraufführung des "Parsifal" folgert Mösch:
"Wagner war, überspitzt gesagt, der erste Regisseur, der an Wagner, dem Musikdramatiker scheiterte."
Insofern bedeutet die fünf Jahrzehnte währende Bewahrung – 'Parsifal' als konserviertes Theater – den vollendeten Verrat an den Intentionen des Komponisten – an seine Forderung: "Schafft Neues, Kinder, schafft Neues!"
Das faszinierende vierte Kapitel ist "aufführungspraktischen Strategien" gewidmet mit erhellenden Ausführungen über die "unsichtbare Seele" des Werks – den neuartigen Orchesterklang. Rückschlüsse auf die musikalische Einrichtung der Uraufführung geben diverse Klavierauszüge von Anton Rubinstein mit Eintragungen von Wagners Mitarbeiter Heinrich Porges, des Bayreuther Studienleiters Julius Kniese, von Cosima und Franz Beidler; die dreibändige Dirigierpartitur; ein Sänger-Auszug der Kundry-Partie aus dem Besitz von Marianne Brandt; endlich jene Zettel, auf denen Cosima während der Proben in einem für sie eingerichteten Verschlag Beobachtungen und Anweisungen für die Künstler notierte. Den musikalischen Details der insgesamt zehn Quellen – sie betreffen Fragen der Vortragsanweisungen, der Deklamation wie der des Ausdrucks, der Tempi und ihrer Modifikationen – dieser "regiebestimmenden Wirkung der Musik" also widmet Mösch ausführliche Struktur-Analysen. Zu diesen aufführungstechnischen Fragen hat er überdies nicht allein die neuere Forschungsliteratur konsultiert – die Studien von Egon Voss, Martin Geck, Gerd Rienäcker und Jürgen Maehder - , sondern auch mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, James Levine und Hartmut Haenchen sowie Orchestermusikern.
Auf der zweiten Ebene seiner Darstellung erfüllt Mösch eine Forderung von Joachim Fest: "Um einen Wagner von außen bittend." Er verfolgt das quälende Zusammenspiel von Ästhetik, Kunst und Religion, das zunächst die Grundlagen für den Bayreuther Parsifal-Kult schuf, dessen universaler Anspruch – das Evangelium des Grals – dem ideologischen Missbrauch Tür und Tor öffnete. Er legt dar, wie das Werk, sein Auftrag und seine Wirkung sukzessive – und nicht selten auf widersprüchliche Weise – mit ideologischen Phantasmagorien angereichert wurden. Etwa dergestalt, dass, wie Mösch über einen geistigen Untermieter in der Ideenwelt Wagners schreibt,
"die Vorstellung des Allgemein- oder Rein-Menschlichen, die bereits bei Wagner zum kulturreligiösen Missionsgedanken tendiert, völkisch überformt wird. Nationales und Universales sind dabei insofern verschränkt, als eine spezifisch deutsche Disposition zur Verwirklichung des Rein-Menschlichen angenommen wird, die auf Kulturimperialismus hinausläuft."
Wagners Träume von der "deutschen Selbstveredelung" finden ihre politische Entsprechung in grauenerregenden antisemitischen Atrozitäten sowohl des Komponisten als auch des intellektuellen Lumpenpacks, das den "Parsifal" in den Dienst deutsch-nationaler und dann antisemitischer Ideologie stellte. Mösch ist weit davon entfernt, wohlbekannte alte Vorwürfe, den Antisemitismus Wagners betreffend, zu wiederholen. Antisemitismus sei, wie Mösch betont, nicht als "Werkauftrag" in den "Parsifal" eingeschrieben. Aber gerade dieses Werk sorgte, gleichsam als Ideen-Souffleur, dafür, dass die Festspiele zu einem "Kult" wurden – und zur Quelle deutsch-nationaler Ideologie mit ihrer Erlösungsfaselei. Mösch konkretisiert dies zum einen durch die Äußerungen von Wagners klugen Affen wie Houston Stewart Chamberlain, zum anderen an einem Einzelschicksal: "Parsifal als Selbstversuch: Hermann Levi."
Es ist die Geschichte des Uraufführungsdirigenten, dem Cosima mit raffiniert sublimierten Sadismus das Verhängnis seiner "Race" deutlich zu machen nicht müde wurde: das den Juden selber von Wagner in seiner schändlichen Schrift "Das Judenthum in der Musik" aufgedrückte Stigma: das der "Kulturunfähigkeit".
"Was Wagner versuchte, verfolgte seine Witwe hartnäckig weiter: Levi als Exempel zu statuieren, bei dem christlicher Geist das Judentum auflösen, nämlich zur Selbstauflösung motivieren könne. Sobald es um die Aufführungspraxis ging, war Qualität keine Sache kapellmeisterlicher Tugenden mehr, sondern eine von Glauben und Glaubensfähigkeit, somit nach den gepflegten Denkrastern einer der Rasse."
Cosima bezeichnete den Dirigenten als Talent, das sich "aus eigener Kraft" am "Genie emporrankte". Seine Konflikte deutete sie als Folge eines seinem Stamme mitgegebenen Fluches:
"Mangel an Glauben, selbst da, wo er Überzeugung hatte, Mangel an Andacht sogar da, wo er verehrte."
Bei seinen Dirigaten, so hielt sie Hermann Levi mit einer Art von sadistischer Seelsorge vor, seien "Glaubensdefizite" spürbar. Und wenn ihr Sohn Siegfried den Dirigenten als Kundry-Natur bezeichnete, wird erkennbar, in welchem Sinne das Werk ideologisch vereinnahmt wurde.
"Die Vorstellung, dass eine primär heidnische, schuldhaft und darin (nicht nur, aber auch) jüdisch konnotierte Symbolfigur es selbst nach der Konvertierung nicht aushält, mit dem ,Schrecken der Heiligkeit‘ konfrontiert zu werden, spricht für eine antisemitisch kontaminierte Erlösungsidee. Diese Idee war anschlussfähig für den mit dem Parsifal geführten Kulturkampf."
Dass es Cosima, von Wagner nicht für die Nachfolge in Bayreuth vorgesehen, gelang, die Festspiele zu etablieren, ist unbestreitbar. Sie hat dies zum einen mit den Mitteln einer "ins Pathetische gesteigerten Witwenschaft" getan,
- zum zweiten im Sinne eines dynastischen Systems,
- zum dritten aber mittels der Überformung der Festspiele durch einen identitätsstiftenden Mythos,
- zum vierten durch ideologische Anpassung, die den faschistischen Massenfang ermöglichte.
Wenn aber nach dem Tod einer charismatischen Gründerfigur die Legitimation kriselt, hilft der Weg nur noch über das Dogma. Ein Bilanz:
"Gesinnung, Gemeindebildung und Gefolgschaft gehören nun in Bayreuth zusammen. Religiöses, regeneratorisches, nationalistisches und rassentheoretisches Verantwortungsbewusstsein ließen sich im Zeichen des Grals mühelos zusammenschweißen."
Wer die Geschichte des Komponisten und die seiner Familie von 1876 bis zur Gegenwart erforscht, so schrieb Hans Mayer vor drei Jahrzehnten in seinem Wagner-Buch "Mitwelt und Nachwelt", schreibt zugleich deutsche Geschichte und Weltgeschichte. Möschs Studie macht einmal mehr und auf schmerzliche Weise deutlich, dass die Geschichte Wagners wie die Wirkungsgeschichte seines Werks nicht abgegolten sind und für jede Generation neu geschrieben werden müssen.
Stephan Mösch: Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit - Wagners "Parsifal" in Bayreuth (1882-1933)
Verlag Bärenreiter-Metzler
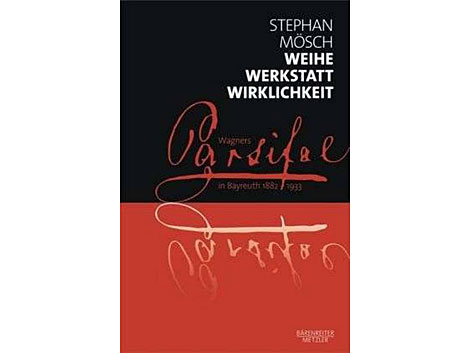
Stephan Mösch: "Weihe, Werkstatt, Wirklichkeit"© Verlag Bärenreiter-Metzler
