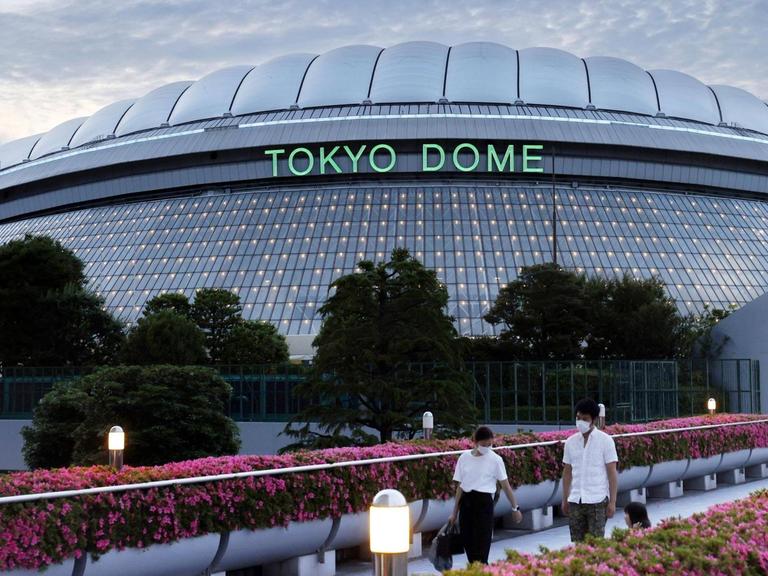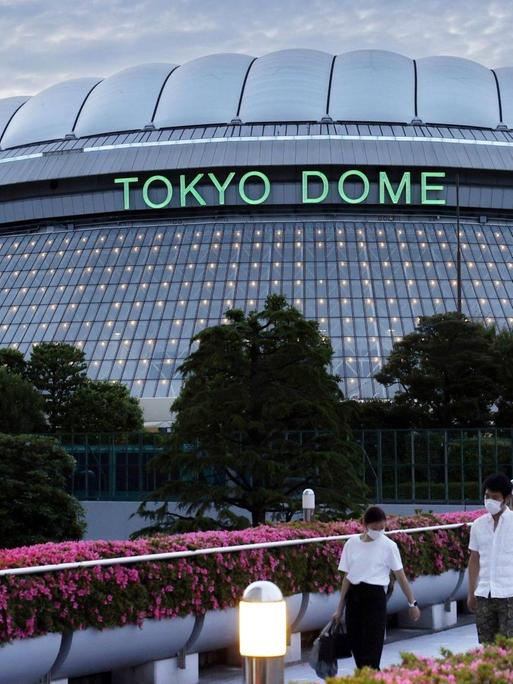Im selben Sturm, aber nicht im selben Boot
21:44 Minuten

Je länger die Ausgangsbeschränkungen in der US-Hauptstadt dauern, desto ungehaltener werden die 700.000 Bürger Washingtons. Auch weil immer deutlicher wird, dass sie die Menschen aus benachteiligten Communitys viel härter treffen.
Am achten Sonntag bekam ich Halluzinationen. Dachte ich. In der Stille meines Gartens meinte ich auf einmal Stimmen zu hören. Gelächter. Und Musik, Blasmusik. Unmöglich! Seit Wochen ist die Stadt wie tot. Wer kann, bleibt zu Hause. Und hier, in meinem Viertel, nehmen sie es besonders ernst. Also: Partystimmung? Konnte nicht sein.
Oder doch? Mit dem Rad fuhr ich dem Geräusch entgegen und fand die Quelle zwei Straßen weiter: Fünf Musiker, vier schwarz, einer weiß, Tuba, Trompete, Posaune, Saxophon, Schlagzeug, am Straßenrand. Funk und Jazz. Drumherum mehr Nachbarn, als ich je zu vor gesehen hatte. Alle schön sechs Fuß auseinander, manche mit Masken, manche ohne.
Laurent aus dem Haus an der Ecke hatte Geburtstag, die Band war eine Überraschung seiner Frau, zur Freude aller. Ein kleiner Moment des Glücks und der Gemeinsamkeit. Washington im "Lockdown", wie das hier heißt, gelassen und hypernervös, gespalten und geeint, unbeteiligt und tief betroffen. Aber tatsächlich meistens zuversichtlich.
Wenn es so etwas wie eine oberste Botschafterin der Zuversicht gäbe, dann wäre es die frühere First Lady. Michelle Obama wird in dieser Stadt heiß geliebt und würde, wenn es nach Washington ginge, sicherlich die nächste Präsidentin. Gerade hat sie sich im Auftrag von Bürgermeisterin Muriel Bowser an die Bürger der Stadt gewandt, um ihnen zu erklären, wie sie an kostenlose Coronatests kommen. Und um sie daran zu erinnern: "We urge you to stay at home." So wandte sie sich in einer Ansprache an die Bürger - also: "Wir bitten Sie dringend, zu Hause zu bleiben, außer wenn Sie unverzichtbare medizinische Hilfe benötigen, wenn Sie sich unbedingt mit Lebensmitteln oder anderem versorgen müssen oder zu Ihrem Hauptberuf gehen. Danke."
8000 Infizierte, 450 Tote
Es ist ernst. Seit Anfang April sind die rund 700.000 Einwohner der Hauptstadt aufgefordert, zu Hause zu bleiben, vorerst bis zum 8. Juni. Aber es kann auch noch viel länger dauern. "Erwarten Sie nicht, dass ein Lichtschalter umgelegt wird, und dass alles wieder zurück auf normal geht", sagt daher auch die Bürgermeisterin Muriel Bowser.
Rund 8000 Menschen sind in der Hauptstadt positiv getestet, etwa 450 Menschen gestorben. Ein Abflachen der Kurve ist nicht zu erkennen.
Maske und Brille, das geht ja gar nicht, wenn man an einem kalten Sonntagmittag versucht, auf dem Farmers Market, dem Bauernmarkt am Dupont Circle einkaufen zu gehen. Beschlägt sofort, und zu verstehen ist man auch nicht richtig. Aber Maske ist Pflicht hier. Ich kaufe Spargel. "Ja, genau von dem grünen Spargel, zweimal bitte", sage ich. Es darf immer nur eine bestimmte Zahl von Menschen auf den Markt, am besten bucht man sich vorher einen Slot.
Das Geschäft geht nur schleppend, sagt der Spargelverkäufer durch seine Maske. Aber er sagt auch: "Wir sind froh, dass wir öffnen können und dass der Markt geöffnet bleiben kann. Wir sind aus Westminister, Maryland."
Wochenmärkte haben in Washington den Stempel "essential" bekommen, das heißt "unverzichtbar". Essential ist das Zauberwort, um sich frei bewegen zu können. Wer im Gesundheitswesen arbeitet, darf das natürlich, auch alle, die irgendwas mit Lebensmittelversorgung, Lieferdiensten, Verkehr, Post und Müllabfuhr zu tun haben. Fahrradläden sind "essential", und auch die Handwerker, Gebäudereiniger und Gärtnerdienste fahren weiter durch die Stadt.
Einkaufen in Maryland und Virginia ist erlaubt
Die Schulen sind geschlossen, Joggen und Radfahren ist erlaubt, aber keine Versammlungen über zehn Menschen. Und das meint Bürgermeisterin Muriel Bowser sehr ernst. "Unser Ziel ist es", sagt sie, "nicht die Polizei einzusetzen. Unser Ziel ist es, dass die Menschen sich an die Regeln halten".
Eigentlich sollen wir den District, wie Washingtons Verwaltungseinheit heißt, nicht verlassen. Aber weil die Stadt so klein ist, darf man nach Maryland und Virginia zum Einkaufen fahren. Nur an den Stränden und in ihren Ferienhäusern waren die Washingtonians nicht willkommen.
Bisher kein Problem, so schlecht wie das Wetter war. Auch der Wetterbericht im Lokalradio macht wenig Hoffnung: Der April war einer der regenreichsten seit Menschengedenken. Und der Mai macht auch keine gute Laune, mit seiner Kälte. Trotzdem müsste die Stadt jetzt voller Menschen sein, wie Mike Litterst erklärt: "Hier kommen die Familien zu den Frühlingsferien, Busse über Busse voll mit Schülern kommen her, und was wir jetzt sehen, ist ein winziger Teil von dem, was wir an einem Tag wie heute sonst so sehen würden."
Mike Litterst ist Chef der Öffentlichkeitsarbeit beim National Park Service und zuständig für die National Mall. Zum Interviewtermin kommt er mit Ranger-Hut, Khakihemd, Maske und vollverspiegelter Sonnenbrille.

Gedenken im Schatten der Coronakrise Der Memorial Day in der National Mall am 25.5.2020.© picture alliance/MPI34/Capital Pictures
Mit "Mall" ist nicht ein Einkaufszentrum gemeint, wie deutsche Touristen denken könnten. "Und viele Amerikaner denken das auch", sagt Litterst. Doch die National Mall ist eine große topfebene Grünanlage zwischen Lincoln Memorial und Capitol, mit dem schlanken Obelisken des Monument in der Mitte, flankiert von den bekanntesten Museen, die die USA zu bieten haben.
35 Millionen Menschen schlendern hier jedes Jahr entlang, doch heute sind nur ein paar Jogger, Radler und Spaziergänger unterwegs. Dabei gibt es etwas zu sehen, das Mike Litterst so noch nie erlebt hat: "Der Rasen ist satt grün, so grün wie womöglich nie zuvor, wunderschön", sagt er. Das liegt zum einen am milden regenreichen Winter und zum anderen an den Millionen von Dollar, die Washington in die Sanierung des Rasens gesteckt hat.
"Als wir mit der Sanierung angefangen haben, haben wir festgestellt, dass der Boden unter dem Rasen die Konsistenz von Beton hatte", erzählt Mike Litterst. "Er bekam kein Wasser, er bekam keine Nährstoffe."
Kein Wunder: Die Mall ist die Partymeile der Nation. Jeder darf hier rein und vor allem drauf auf den Rasen. Hier wird gepicknickt, hier gibt es Konzerte, hier wird demonstriert und gefeiert. Und das überlebt keine Grünfläche der Welt.
Ohne Besucher und ohne Partys leuchtet der frische Rasen prächtig grün wie nie. Dass er nun eine echte Chance hat, sich zu erholen, findet Naturfreund Mike Litterst natürlich gut, aber er schaut sich das fette Grün mit gemischten Gefühlen an."Die Mall ist ein Ort, um zusammenzukommen", sagt er. "Und das nicht zu haben, ist ein großer Verlust für die Menschen in Washington und den ganzen USA".
LKW-Fahrer unter Druck
Auch wenn die Versammlungsfreiheit derzeit eingeschränkt ist, eine Demonstration durchbricht dann doch die Stille der Mall. Auf der Constitution Avenue stehen weit über 100 Zugmaschinen und lassen die Motoren laufen. "Make trucking great again" steht an den Türen oder "Truckers are essential". Lastwagenfahrer sind unverzichtbar, gerade jetzt, und doch stehen sie seit Tagen hier und demonstrieren gegen den Preisdruck der Vermittler, sagt Roman, ein junger LKW-Fahrer aus Cleveland, Ohio. "Wenn sie, sagen wir mal, früher drei Dollar pro Meile bezahlt haben, zahlen sie jetzt 80 Cent oder 50", beschwert er sich. "Um auf unsere Kosten zu kommen, bräuchten wir wenigstens zwei oder zwei Dollar fünfundzwanzig."
Weil die Wirtschaft stillsteht, sind auch deutlich weniger Güter unterwegs und das nutzen die Auftraggeber aus, um die Fahrer auszupressen. Viele müssen ihre Maschinen abbezahlen, 150.000 bis 170.000 Dollar kostet so ein Truck, sagt Roman, dazu kommen noch die Anhänger. Aufträge abzulehnen, können sie sich eigentlich nicht leisten. Wenn sie eine Fracht annehmen, müssten sie das aus eigener Tasche bezahlen, die Fracht auszuliefern.
Roman hat zwei Kinder und muss ein Haus abbezahlen, wie so viele Amerikaner kommt er mit der monatlichen Rate gerade nicht hinterher. Wie lange er das noch durchhält? "Solange wie die Bank das mitmacht", sagt er.
Oder bis der Präsident einschreitet. Donald Trump mag Trucker, wie er gerade erst wieder im Fernsehsender Fox News betonte. Sie mögen Trump, viele haben Trump auf ihren Trucks stehen, sagte der Präsident kürzlich. Er habe seine Mitarbeiter vom Weißen Haus aus losgeschickt, um rote Trump-Kappen vorbeizubringen. "Sie wollen fair behandelt werden", sagte Trump. "Also kümmern wir uns um sie."
Am Capitol gilt: Nur ein Passagier pro U-Bahn-Waggon
Wochenlang war das Capitol wie ausgestorben. Das knochenweiße Gebäude mit der charakteristischen Kuppel am Ende der Mall beherbergt den Senat mit seinen 100 Senatoren, zwei aus jedem der 50 Bundestaaten, und die 435 Mitglieder des Abgeordnetenhauses.
Die beiden Flügel des Hauses werden unterirdisch durch eine kleine U-Bahn verbunden. In Coronazeiten darf in jedem Waggon nur ein Mensch sitzen. Zu Fuß ist man schneller, die Wartezeit wäre viel zu lang. Der Senat ist seit Anfang Mai aus seiner Coronapause zurückgekehrt, ein Zeichen der Solidarität, wie Mitch McConnell, der Chef der Republikaner meinte.
"Wenn es unabdingbar ist, dass die mutigen Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Supermärkte, die LKW-Fahrer und viele andere Amerikaner weiter vorsichtig zur Arbeit gehen", sagt Mitch McConnell, "dann ist es auch unabdingbar, dass wir US-Senatoren selber arbeiten gehen und sie unterstützen."

Ein Zeichen der Solidarität nennt der republikanische Senator Mitch McConnell das Ende der Coronapause des Senats.© imago / MediaPunch/Stefani Reynolds
Aber das mit dem Arbeiten ist gar nicht so einfach. Die Republikaner und ihr Präsident halten das Virus zwar für weniger gefährlich, als die Demokraten das tun. Trotzdem herrscht überall Maskenpflicht. Und ausgerechnet eine wichtige Anhörung darüber, wann sich das Land denn wieder öffnen kann, musste als Videokonferenz ablaufen, weil wichtige Experten in Quarantäne gegangen waren, darunter auch Anthony Fauci, der beliebteste und bekannteste Virologe des Landes.
Und so sind die engen Flure im Senat leer, nur manchmal huscht ein Mensch mit Maske vorbei. Der Stimme nach könnte das Chuck Schumer gewesen sein, der oberste Demokrat im Senat, auf dem Weg zu seinem Pressestatement. Nur wenige Journalisten sind zugelassen. Ich nicht.
"We're in this together" – ein fadenscheiniger Satz
"We're in this together!" – wir stecken hier alle gemeinsam drin – ist oft zu hören. Aber je länger es dauert, desto fadenscheiniger wird der Satz. Die Menschen in Washington stecken womöglich im selben Sturm, sitzen aber doch in sehr unterschiedlichen Booten.
"Wenn ein Mensch maskiert ist, verschlechtert sich die stimmliche Qualität. Die Sprache wird gedämpft", sagt Christian Vogler. Oder besser: Er signalisiert es, denn Christian Vogler ist taub. Und weil ich wiederum seine Sprache nicht verstehe, die amerikanische Zeichensprache ASL, hören wir nun Adam Bartley, den Gebärdendolmetscher.
Christian Vogler, ein gebürtiger Deutscher von Ende 40, ist Professor an der Gallaudet University von Washington, einer über 150 Jahre alten, weltweit einzigartigen Einrichtung, die taube und schwerhörige Studenten unterrichtet und – natürlich – forscht.
Das Coronavirus trifft die Community besonders. "Wenn jemand an Covid-19 erkrankt und in die Notaufnahme muss, trägt dort jeder Schutzkleidung. Und daran lässt sich nichts ändern", sagt er. Doch er fragt: "Also, was tun wir? Wie können wir kommunizieren? Wenn man hinter den Masken nicht mehr Lippenlesen kann, die Stimmen schlecht versteht und auch niemanden berühren darf, wird das schwierig."
Seine Antwort ist: "Alle wichtigen Apps aufs Handy laden, Informationen ausdrucken, klar machen, dass man schlecht oder gar nichts hört".
80 Prozent der Coronatoten sind Afroamerikaner
Christian Vogler forscht an der Uni, wie sich die neuen Technologien nutzen lassen. Kann Alexa Zeichensprache lernen? Wie lassen sich Untertitel fürs Fernsehen optimieren? Und ganz wichtig: Wie lassen sich Videokonferenzen gestalten, bei denen sich eine ganze Schulklasse ansehen kann, fragt auch Robert Weinstock, Pressesprecher der Uni, über seine Dolmetscherin Jamie Yost.
"Wir hören nicht, wir schauen, wir nutzen unsere Augen", sagt er. "Wir müssen verfolgen, wer spricht, wir müssen das Rederecht auf visuelle Art verteilen."
Die rund 1600 Studenten sind nun zu Hause, wo sie womöglich niemanden haben, der mit ihnen in Zeichensprache kommunizieren kann. Mit wöchentlichen virtuellen Townhalls versucht die Uni, Fragen zu beantworten und Gemeinschaft zu stiften. Da nehmen dann per Facebook schon mal 100.000 Leute aus aller Welt teil. Gallaudet, sagt er, sei ein Zeichen der Hoffnung für alle tauben Menschen in aller Welt.
Auch für viele Afroamerikaner gilt die Beschwörungsformel "We're in this together" nicht. 80 Prozent der Menschen, die hier an Covid-19 sterben, sind schwarz. Je schwärzer und ärmer die Bevölkerung eines Stadtbezirks, desto stärker ist er von Corona betroffen.
Hinter der Brücke nach Anacostia beginnt eine andere Welt
Paradebeispiel ist der Stadtteil Anacostia im Südosten, auf der anderem Seite des Flusses. Hier fallen nachts oft Schüsse, hier sterben mehr Menschen durch Kugeln als sonstwo in Washington.
"Wenn du über die Brücke kommst, kommst du in eine ganz andere Welt", sagt Joe Houston. "Uns fehlen hier die Ressourcen, die Gesundheitsversorgung, die Möglichkeiten. Wir brauchen mehr Chancen und mehr Menschen, die wählen gehen."
Joe Houston ist ein junger Afroamerikaner aus Anacostia, den das Fernsehteam aus unserem Studio begleitet hat. Die Kombination von Armut, unsicheren Lebensverhältnissen und schlechter Versorgung fördert chronische Krankheiten und macht die Menschen damit anfälliger für das Virus.
"Die Leute brauchen frische Sachen, da gibt es eine große Nachfrage", erzählt Houston. "Wir haben hier große Gesundheitsprobleme, Diabetes, hoher Blutdruck, Asthma. Wir müssen besser essen und uns besser erziehen."
Joe war im Gefängnis, weil er drei Menschen angeschossen hat. Jetzt engagiert er sich für seine Leute, er verteilt Lebensmittel und versucht Jugendlichen zu helfen, der Bandengewalt und Kriminalität zu entkommen. Viele junge Leute, sagt Joe, glauben, dass das Virus für sie keine Gefahr ist. Aber er ist auch realistisch: "Ich weiß, dass wir Covid ernstnehmen müssen, aber eines der wichtigsten Viren hier ist die Kriminalität von Schwarzen an Schwarzen. Wir bringen uns gegenseitig um. Mit hilflosen, ekligen Verbrechen."
Mit militärischem Brimborium werden die Helfer gefeiert
Als Donald Trump die Gefahr nicht mehr wegleugnen konnte, dachte er sich eine neue Rolle für sich aus: die Rolle des Kriegspräsidenten im Kampf gegen den unsichtbaren Feind.
Den Bürgern verlangte er Opfer ab, die medizinischen Helfer erklärte er zu Helden und feierte sie, wie sich das gehört, mit militärischem Brimborium.
Am Ufer des Potomac, unterhalb des beliebten Stadtteils Georgetown haben am ersten Samstag im Mai hunderte von Menschen die Stay-at-Home-Anweisung ignoriert. Donald Trump hat angekündigt, dass er zu Ehren aller Helfer die Blue Angels und die Thunderbirds aufsteigen lassen will. Und so stehen sie nun mit Kindern, Hunden und Fahrrädern unterm blauen Himmel und bestaunen die beiden Fliegerstaffeln, wie sie große Schleifen über dem Raum Washington ziehen.
"Das verstärkt unglaublich die Moral, es bringt alle Leute zusammen, es ist patriotisch!", sagt Kay. Sie selbst ist Krankenschwester, ihre Töchter sind auch Krankenschwestern, die Männer beim Militär. "Das unterstützt die, die an der Front arbeiten, im Gesundheitswesen, in den Schützengräben. Die jeden Tag versuchen, es für uns sicherer zu machen."
Dreimal ziehen die Jets in perfekter Formation über uns hinweg. Für Kay und andere ein Zeichen für Gemeinschaft und Hoffnung.

Ein Konzert mit gemeinschaftsstiftender Wirkung.© Katrin Brand
Für stärkende Gemeinschaftserlebnisse braucht Washington aber in der Regel keine teuren Flugshows. Die wohl verbreitetste Wohnform der Stadt ist das Reihenhaus, und die kleinste nachbarschaftliche Einheit ist der Block, also mehrere Reihenhäuser, die durch eine schmale Hinterhofstraße erschlossen werden. Und in einer solchen Alley im Stadtteil Brookland im Nordosten der Stadt geben Elise und David gerade ein Konzert.
Posaune und Violine, ein ungewöhnliche Kombination - aber es sei nun mal das, was sie haben, sagt David. "Wir machen in diesen Zeiten das Beste draus." Er bläst seine Posaune normalerweise im National Symphony Orchestra, Elise spielt Violine als Freiberuflerin. Und sie vermissen es, Konzerte zu geben. "Wir wussten nicht, wie sehr wie es vermissen", sagt sie, "bis wir angefangen haben, hier in der Alley zu spielen."
Bach, Bizet, Kinderlieder, die beiden haben sich Bekanntes und Unbekanntes für ihre beiden Instrumente umgeschrieben. In meinen Ohren klingt es gerade in seiner Unfertigkeit - perfekt. Die Nachbarn haben mir einen Stuhl dazu gestellt. Wir sitzen in sicherem Abstand im Halbkreis, ein Dutzend Erwachsene, Kinder, Hunde, und genießen unangestrengt den Trost der Gemeinschaft.
"Unser Block", sagt Nachbarin Maura, "ist über die vergangenen Wochen unsere Familie geworden. Das ist ein Segen.