Ronya Othmann: "Die Sommer"
Hanser Verlag, München 2020
288 Seiten, 22 Euro
Dmitrij Kapitelman: "Eine Formalie in Kiew"
Hanser Berlin, Berlin 2021
176 Seiten, 20 Euro
Usama Al Shahmani: "Im Fallen lernt die Feder fliegen"
Limmat Verlag, Zürich 2020
240 Seiten, 24 Euro
Lena Gorelik: "Wer wir sind"
Rowohlt Berlin, 2021
320 Seiten, 22 Euro
"Migration hört eigentlich nie auf"
29:55 Minuten

Wer seine Heimat verlässt, lebt fortan in zwei Welten. Wie wird aus dieser Erfahrung Literatur? Wie verändert sich das Verhältnis zur ehemaligen Heimat und zu deren Sprache? Autoren und Autorinnen berichten.
Seit Jahrzehnten bereichern Autor*innen, deren Eltern aus einem anderen Land nach Deutschland eingewandert sind, die deutsche Literatur. Sie sind gewissermaßen in zwei Welten aufgewachsen. Was für ein Verhältnis entsteht zur ehemaligen Heimat und zu deren Sprache?
"Das Brot schmeckt anders als im Dorf"
"Die Tomaten schmecken in Deutschland anders als im Dorf", sagt Ronya Othmann. "Und das ist immer so: Jede Tomate, die gegessen wird, wird an den Dorftomaten gemessen."
Dimitrij Kapitelman findet, dass mit der Migration ganz viel Selbstverständlichkeit verschwindet: "Und das hört auch nicht nach ein paar Jahren auf, wenn scheinbar die Wohnung gefunden ist und die Arbeit und die Sprache gelernt."
Und wie wird aus diesen Erfahrungen Literatur? Lena Gorelik meint dazu: "Dann ist immer auch die Frage im Hintergrund: Darf ich diese Geschichte erzählen? Ist das meine Geschichte, wem gehört die?"
"Wer wir sind"
Lena Gorelik lebt seit 1992 in Deutschland. Ihre Eltern hatten beschlossen, Sankt Petersburg zu verlassen und mit den beiden Kindern und der Großmutter nach Deutschland auszuwandern, als jüdische Kontingentflüchtlinge.
Lena Goreliks Buch "Wer wir sind" ist ein Roman. Doch alles, was darin erzählt wird, hat die Autorin selbst erlebt, wie sie sagt:
"Die Kunst des Romans liegt ja nicht im Erfinden der Geschichte, sondern in der Kunst des Erzählens."
Der Titel "Wer wir sind" ist Programm: Lena Gorelik erklärt, was es bedeutet, die vertraute Welt zu verlassen und sich in eine ganz andere Welt einzufinden. So erzählt sie etwa von der Scham und der Angst des Fremdseins, angefangen mit dem Asylantenwohnheim in der schwäbischen Kleinstadt, wo die Familie die ersten anderthalb Jahre in Deutschland verbringt.
Sprache als Eintrittskarte
Doch die elfjährige Lena behauptet sich in der Schule, wenn auch als Außenseiterin, rasch lernt sie die deutsche Sprache, die zwei Funktionen hat: Sie ist die Eintrittskarte in die neue Gesellschaft, und sie dient als Abgrenzung gegen die Herkunft.
Für ihre Eltern ist Migration eine ganz andere Geschichte: Sie bezahlen für die Auswanderung mit dem Verlust dessen, was sie in ihrem bisherigen Leben geleistet hatten.
Doch es ist nicht nur der Statusverlust, der die Eltern in der neuen Welt umtreibt, sondern auch die Gefahr der Entfremdung von ihrer Tochter.
Die Einbürgerung zwingt zur Rückkehr
Dmitrij Kapitelman war acht Jahre alt, als seine Eltern mit ihm, seiner Schwester und der Großmutter Kiew verließen. Sie kamen ebenfalls als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland.
Auch Dmitrij Kapitelmans Roman "Eine Formalie in Kiew" ist autobiografisch: Der Icherzähler Dima fliegt nach Kiew. Er will sich, nach 25 Jahren Aufenthalt im Land, in Deutschland einbürgern lassen und dafür muss er ein Dokument besorgen, das er nur in Kiew bekommen kann.
Ausgerechnet die deutsche Einbürgerung zwingt den Autor also zur Rückkehr in die ehemalige Heimat. Diese Ironie des Schicksals hat Dmitrij Kapitelman in einen überaus komischen und ebenso tragischen Roman verwandelt.

Der Journalist und Autor Dmitrij Kapitelman© Deutschlandradio / Cara Wuchold
Die Reise in die Stadt der Kindheit ist für Dima eine Erfahrung voller Widersprüche. In der ersten Hälfte des Romans geht es um die bürokratischen Herausforderungen, um das Dokument während der zwei Wochen zu beschaffen, die Dima in Kiew bleiben will.
Im zweiten Teil kommen auch die Eltern nach Kiew, sodass sich die Rückreise verzögert. Denn an dem Tag, an dem Dima eigentlich hätte nach Deutschland zurückfliegen wollen, ist auf einmal sein Vater am Handy und kündigt ihm an, sich in der Ukraine neue Zähne machen lassen zu wollen.
Neue Zähne und eine Versöhnung
Wie sich zeigt, sind die verlorenen Zähne das kleinere Problem. Der Vater braucht neurologische Untersuchungen, und die sind in der Ukraine billiger als in Deutschland. Er hat seine Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt und ist deshalb aus der Versicherung geflogen. Nun muss sein Sohn sich in Kiew um ihn kümmern.
Dass gut drei Wochen später auch Dimas Mutter in Kiew landet, hätte sich der Autor von "Eine Formalie in Kiew" nicht ausdenken können, wie er erzählt:
"Das war mir zum Beispiel auch nicht klar, dass das das Ziel der Reise werden würde, dass die ganze Familie sich in Kiew wiedertrifft und versöhnt, und zwar unter den widrigsten und dramatischsten Umständen. Das konnte ich ja gar nicht kommen sehen."
Das Ende der jesidischen Dörfer
"Als der Genozid an den Jesiden passiert ist, das war zum ersten Mal, dass mein Vater gesagt hat, ich werde nicht zurückkehren, es gibt keinen Ort mehr, an den wir zurückkehren können", sagt Ronya Othmann, deren Vater kurdischer Jeside ist und damit in seiner Heimat Syrien staatenlos war.
Nach einer traumatischen Flucht kam er 1980 nach Deutschland, mit seiner deutschen Frau hat er vier Kinder. Ronya Othmann erzählt im Roman "Die Sommer" die Geschichte ihrer eigenen Familie. Bis 2011 verbrachte diese jeden Sommer im Heimatdorf ihres Vaters, in Nordsyrien nahe der türkischen Grenze.
Wie für die Autorin enden auch für Leyla die Besuche im Jahr 2011, die Familie sitzt in Deutschland vor dem Fernseher, hofft auf die Revolution und das Ende der Assad-Diktatur. Doch dann zerschlagen sich alle Hoffnungen, bis hin zum Genozid an den Jesiden durch die Islamisten.
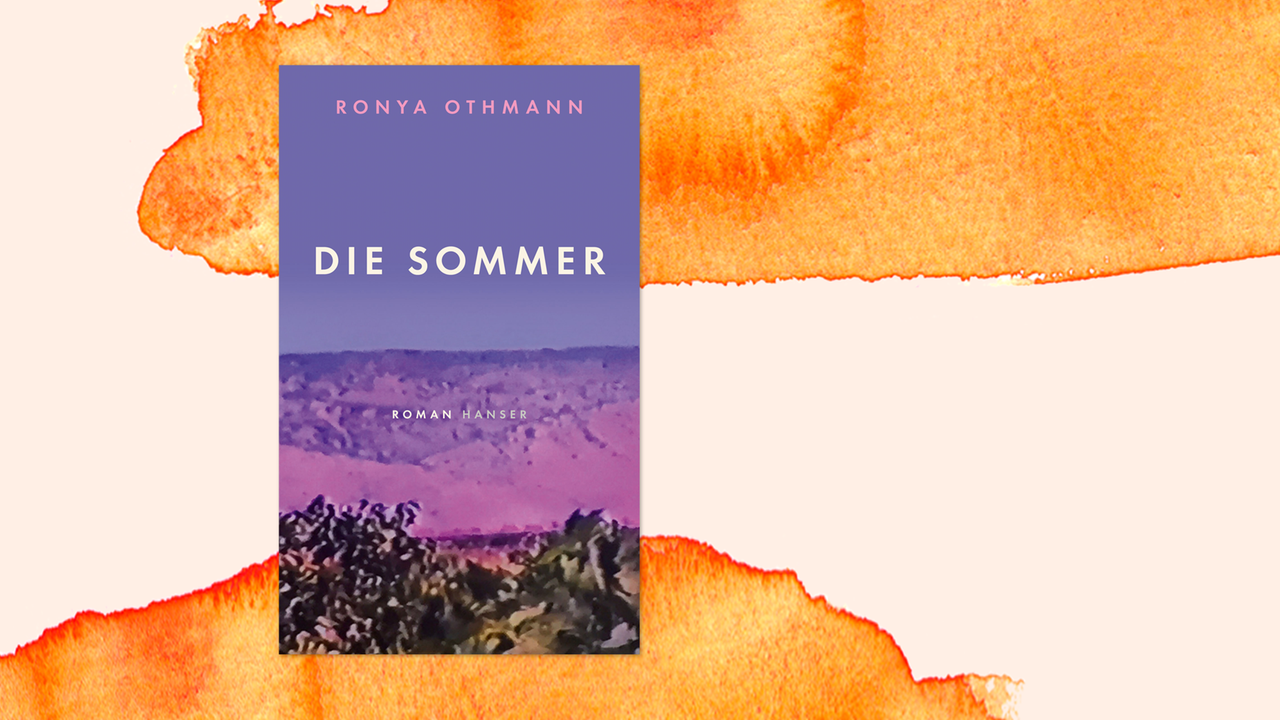
Als IS-Kämpfer in das Dorf einfielen, begann Ronya Othmann mit ihrem Roman.© Hanser Verlag / Deutschlandradio
Othmann erzählt: "2014, als ja auch der IS sich breitmachte, war klar, dass das wahrscheinlich das Ende ist von den jesidischen Dörfern oder der jesidischen Welt in Nordostsyrien. Und das war der Punkt, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben."
Im Roman ist Leyla inzwischen Studentin. Während sie um das Leben ihrer jesidischen Verwandten fürchtet, geht in Deutschland alles seinen gewohnten Gang, was zu einer Fremdheitserfahrung führt, die auch die Autorin gut kennt.
Erfahrungen des Fremdseins
Um Fremdsein geht es auch in dem zweiten Roman des irakisch-schweizerischen Autors Usama Al Shahmani "Im Fallen lernt die Feder fliegen". Darin erzählt er nicht seine eigene Geschichte, sondern es geht um eine Familie, die in den 80er-Jahren vor Saddam Hussein aus dem Irak geflohen ist, zuerst in den Iran und dann weiter in die Schweiz.
Die Icherzählerin Aida ist seit neun Jahren mit Daniel zusammen, sie liebt ihn, doch auf seine ewigen Fragen nach ihrer Herkunft mag sie nicht antworten. Was Aida Daniel nicht erzählen kann, schreibt sie auf: Das ist der Text, den wir in diesem Roman lesen.
Gleich nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2007 beschließt der Vater, in den Irak zurückzukehren. Die beiden Töchter sind inzwischen vierzehn und siebzehn Jahre alt, sie sind in der Schweiz aufgewachsen. Das Heimatdorf ihrer Eltern ist ihnen fremd.
Als die ersten Heiratsgespräche beginnen, beschließen sie heimlich, in die Schweiz zurückzukehren. Auch für die Eltern ist die Rückkehr in das Heimatdorf eine Enttäuschung.
Usama Al Shahmani ist 2002 selbst aus dem Irak in die Schweiz geflohen, spricht also aus Erfahrung, wenn er sagt:
"Diese Fremde, das sage ich jetzt ganz offen, diese Fremde habe ich auch erlebt, in Bagdad oder im Südirak. Da habe ich mich auch gefragt: Was verbindet mich jetzt mit dem Ort, mit den Menschen da? Mit der Sprache, mit allem, was geschah?"
Schreiben als Balanceakt
Die Geschichte, die Al Shamani erzählt, ist fiktional. Doch wer von der Migration erzählt, schreibt fast immer über die eigene Familie. Dazu bedarf es nicht der ersten Person Singular, wie Ronya Othmann erzählt:
"Ich habe nicht die Ich-Perspektive gewählt, vielleicht auch, um Distanz zu schaffen. Es gibt ja viele Ähnlichkeiten zwischen Leyla und mir. Ich wollte aber nicht über mich erzählen, sondern ich wollte eher von etwas erzählen, was ich kenne."
Mit ihrem Roman rührt Ronya Othmann an viele Tabus ihrer jesidischen Familie. Das Schreiben über die eigene Familie sei ihr nicht leichtgefallen, sagt auch Lena Gorelik: "Ich schreibe ja auch viel über die Frage, darf ich oder darf ich nicht. Das ist kein Trick, das ist wie der Versuch, Verantwortung zu übernehmen."
Ein Balanceakt, sei das, sagt Dimitrij Kapitelman: "Es gibt einfach auch kein Schreiben wie das Schreiben über die eigenen Eltern. Es gibt keines, das so intensiv ist, wo der Draht zu den tiefsten Emotionen so direkt und kurz ist."
Vom Leben in zwei Sprachen
Wer in zwei Welten lebt, lebt auch in zwei Sprachen. Das Russische ist aus den Romanen von Lena Gorelik und Dmitrij Kapitelman nicht wegzudenken. "Ich mache mit der deutschen Sprache, was ich will, und wenn ich Lust habe, nehme ich die russische noch dazu", erzählt Lena Gorelik, in deren Text immer wieder russische Wörter auftauchen, jeweils in kyrillischen Buchstaben.
Dmitrij Kapitelman macht seine Zweisprachigkeit auf andere Weise literarisch fruchtbar. Er nimmt sich die Freiheit, im Deutschen Wörter und Redewendungen zu erfinden.
"Die Dinge kriegen Distanz, wenn sie in einer fremden Sprache geschrieben werden", sagt Usama Al Shahmani. "Und diese Distanz schafft für mich Raum, in dem ich mich frei bewege."
Dass die Migration sich in der nächsten Generation fortsetzt, diese Erfahrung machen alle, die in zwei Welten leben.
"Ich hab mich schon vor einer Weile von dem Konzept von richtiger Zugehörigkeit verabschiedet", sagt Kapitelman. "Ich hab mich dagegen dem Gefühl der Verbundenheit angenähert, weil das in meinen Augen etwas weniger Ausschließendes und Definitives ist."
Usama Al Shamani sieht sich als Weltbürger, "Heimat" ist ihm als politisch aufgeladener Begriff suspekt. Und Lena Gorelik meint:
"Es ist schön, dass die Migration nie aufhört, es ist schön, dass das weitergeht. Meine Kinder sind ja hier geboren, und wenn ich an denen noch Spuren der Migration finde, dann freue ich mich immer, dann freue ich mich, dass die noch so ein bisschen Migration mitbekommen haben, so ein Stückchen."






