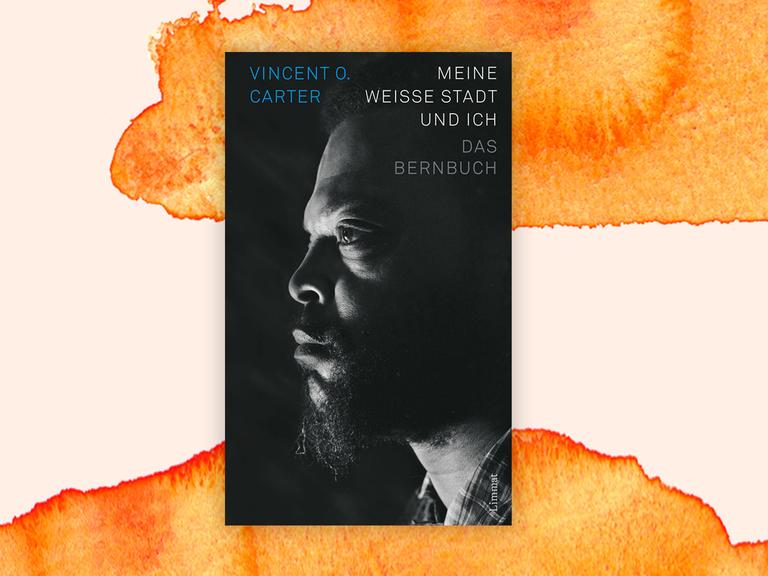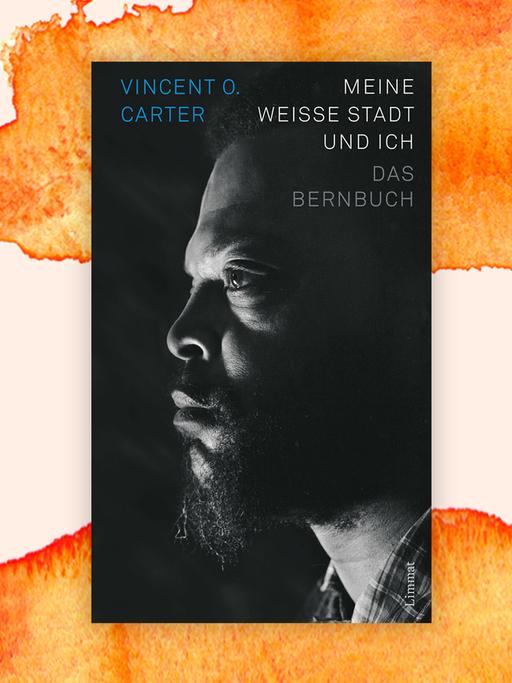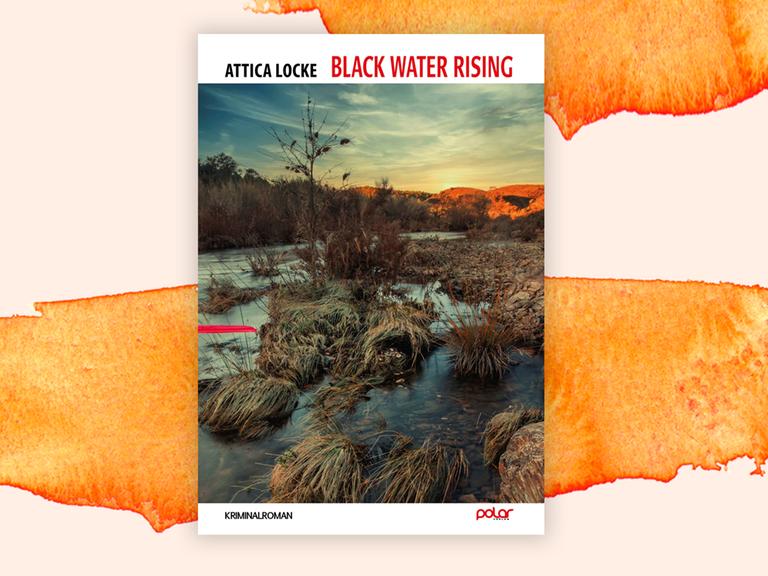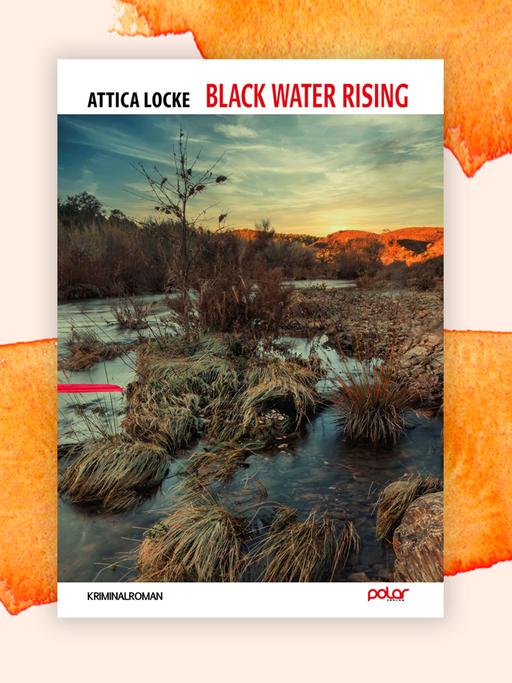William Melvin Kelley: "Ein Tropfen Geduld"
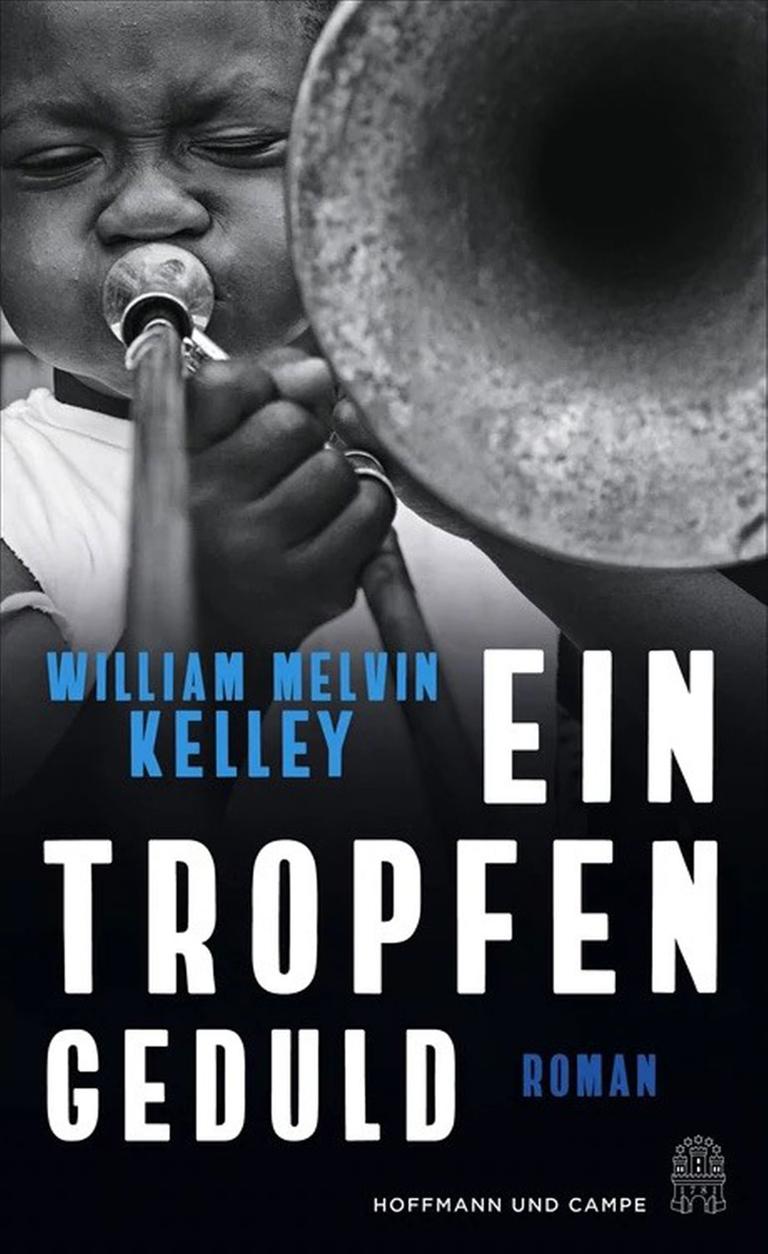
© Coverabbildung: Verlag Hoffmann und Campe
Ein blinder Jazzmusiker sieht Hautfarben
33:01 Minuten
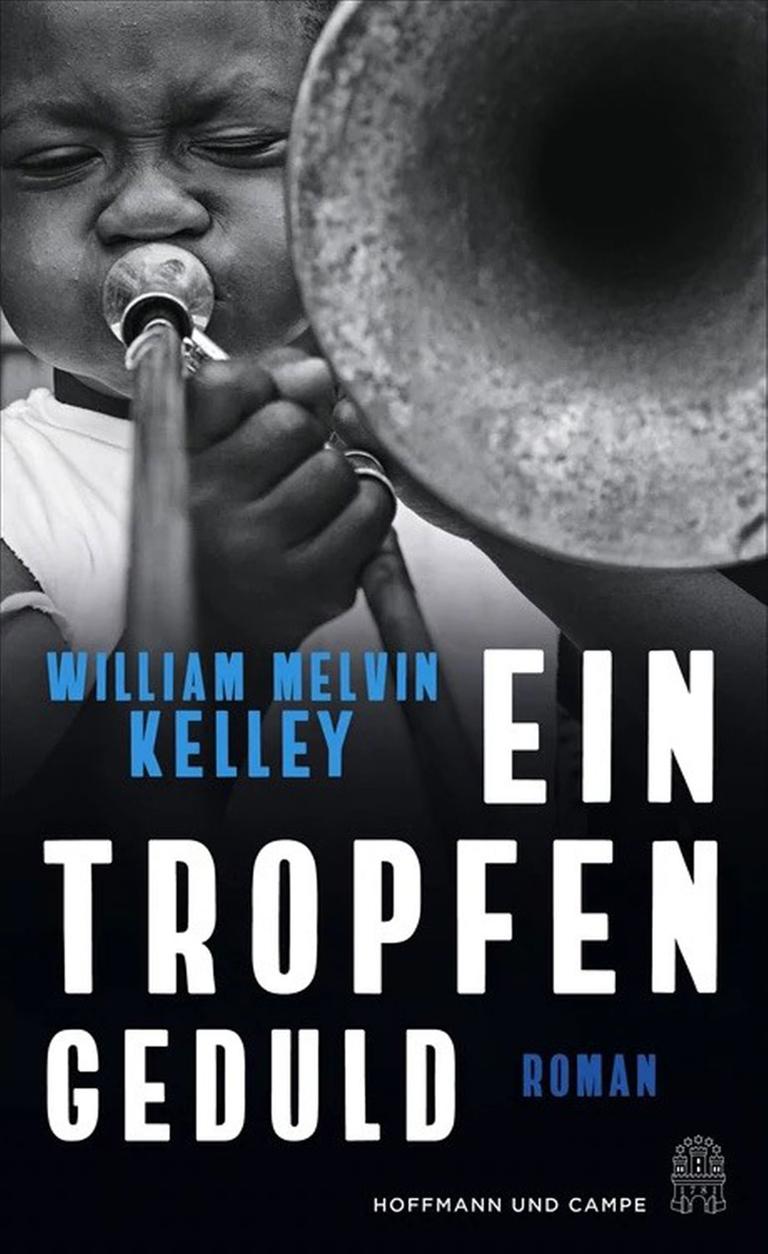
William Melvin Kelley
Übersetzt von Kathrin Razum
Ein Tropfen GeduldHoffmann und Campe, Hamburg 2021284 Seiten
24,00 Euro
Vom Blindenheim in die Jazzclubs: Ludlow gelingt ein phänomenaler Aufstieg. Doch erlebt er als schwarzer, blinder Musiker auch Rassismus, Diskrimierung und Spott. William Melvin Kelley erzählt seine Geschichte entlang der Entwicklung des Jazz.
Es gibt eine Szene, in der der schwarze, blinde Jazzmusiker Ludlow Washington sein Gesicht schwarz schminkt und vor einem weißen Publikum rassistische Witze erzählt. Dies ist jedoch keine Parodie auf die sogenannten Minstrel Shows, bei denen Weiße mit schwarz geschminktem Gesicht Stereotype von Schwarzen darstellten, sondern ein Akt schierer Verzweiflung. Denn Ludlows weiße Freundin hat ihn verlassen und in eine tiefe Krise gestürzt. „Was glaubst du, was die Weißen von uns wollen“, fragt er seinen Musikerkollegen. „Sie wollen, dass wir das sind, wofür sie uns halten.“
Brutales Aufwachsen in den Südstaaten
Doch welche Vorstellungen von Hautfarbe hat jemand, der von Geburt an blind ist? Mit fünf Jahren hat seine Familie Ludlow in ein Blindenheim gegeben. Es sind die 1920er-Jahre in den Südstaaten der USA. Hier erfährt er eine brutale Hackordnung, als einer der älteren schwarzen Jungen ihn zu seinem Sklaven erklärt. Und er lernt, dass schwarze Menschen anders als weiße und letztere angeblich mehr wert seien.
Später wird er versuchen, herauszufinden, was das andere Aussehen ausmacht. So bittet er seine schwarze Zimmerwirtin, ihr Gesicht ertasten zu dürfen. „Manchmal glaub ich, dass die Weißen sogar die Schönsten von uns hässlich finden“, sagt diese.
Musizieren statt betteln
Im Heim hat Ludlow ein Instrument gelernt, um nicht vom Betteln leben zu müssen – ein Blasinstrument, das nicht näher beschrieben wird. Ein Bandleader erkennt sein Talent, kauft ihn frei und lässt ihn in einer heruntergekommenen Bar auftreten. Sein eigener Stil macht ihn bald zum Geheimtipp. Eine berühmte New Yorker Jazzsängerin kann ihn abwerben, als er volljährig ist.
Dass jemandem seine Musik gefallen könnte, begreift Ludlow zunächst nicht: „Die Musik sei einfach nur eine Methode gewesen, um nicht mit einer Blechtasse auf der Straße zu landen“, heißt es an einer Stelle. Sein Ruhm wächst, später geht er zu einer Big Band und gründet schließlich eine eigene Gruppe.
Erfolgsgeschichte des Jazz
Rassismus, Demütigungen und Spott bekommt er trotz seines Erfolgs zu spüren. Sein geduldiges Streben, sich von dem Bild, das Weiße von Schwarzen haben, zu befreien, erzählt Kelley entlang der Erfolgsgeschichte des Jazz – von den Big Bands, zu deren Musik man tanzte, hin zu einer komplexen Musik als Kunstform, der man in kleinen Clubs zuhörte.
Kelley habe sich von Charlie Parker, dem Erfinder des Bebop, sowie von Thelonius Monk inspirieren lassen, schreibt seine Frau in einer Nachbemerkung zur Entstehung des Romans. Ludlow allerdings bestreitet in einer der fiktiven Interviewpassagen, die jedem der sechs Teile des Romans vorangestellt sind, der Erfinder des Modern Jazz zu sein. Er habe immer nur das gespielt, was ihm gefiel, und mit Genialität habe das nichts zu tun, sondern mit Üben, erklärt er lapidar.
Rassisten sind blind
Der Jazz inspirierte viele afroamerikanische Autorinnen und Autoren in den 1950er- und 1960er-Jahren, die Charaktere erschaffen wollten, die sich nicht allein durch Unterdrückung definierten. Kelleys Roman ist zwar das lakonisch erzählte Porträt eines Jazzmusikers, das einen in die Welt der kleinen Clubs mitnimmt, bedient aber keine Klischees - Alkohol oder Drogen sind für Ludlow kein Thema.
Der Erzähler ist wunderbar nah dran an Ludlow. Wir erfahren, wie er als Blinder die Welt wahrnimmt: was er hört, riecht, fühlt. Und der Roman suggeriert, dass blind auch sei, wer sich rassistisch verhalte. Und dass jemand, der gezwungen sei, sich durch die Augen anderer zu sehen, sich selbst nicht mehr sehen könne. In dieser Hinsicht könnte dieser faszinierende Roman kaum aktueller sein.