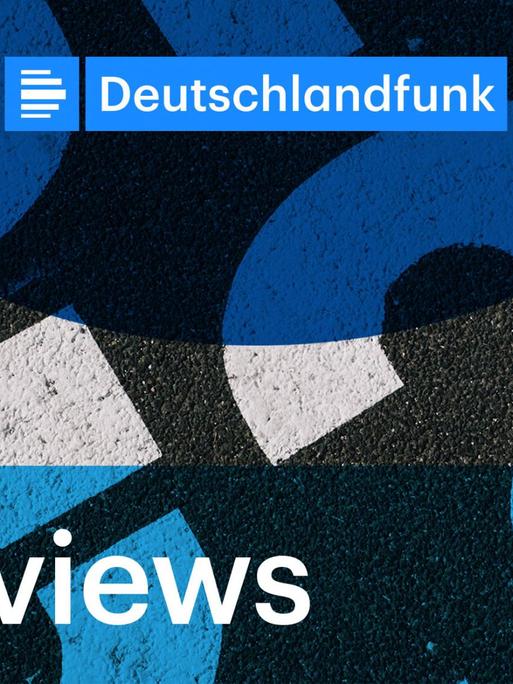"Wir hätten jetzt die Möglichkeit, diese Krise ein für alle Mal zu beenden"
Das derzeitige Volumen des Rettungsschirms sei nicht groß genug, um das Vertrauen der Finanzmärkte zu gewinnen, sagte Henrik Enderlein von der Hertie School of Governance. Deutschland könne ein Signal setzen und dafür sorgen, "dass das Feuer aus ist".
Gabi Wuttke: Der Fiskalpakt, aber auch der zweite Euro-Rettungsschirm – heute debattiert der Bundestag in erster Lesung über sehr, sehr viel Geld. Das Ja der Kanzlerin, den Rest aus dem ersten Rettungsschirm bereitzuhalten, während der ESM für die nachhaltige Stabilisierung Europas sorgen soll, das dürfte im Mittelpunkt stehen. Am Telefon ist der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Henrik Enderlein von der Hertie School of Governance, einen schönen guten Morgen!
Henrik Enderlein: Guten Morgen!
Wuttke: Sie haben schon länger für diese Zusammenlegung plädiert. Warum ist das für Sie die richtige Entscheidung?
Enderlein: Ja, es gibt zwei zentrale Gründe: Der erste ist, dass wir immer noch nicht einen Rettungsschirm haben, der groß genug ist, um den Finanzmärkten klar zu signalisieren, dass in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Portugal und in Irland nichts mehr anbrennen kann. Diese 500 Milliarden, die bislang auf dem Tisch waren, die waren einfach immer zu wenig, um die Märkte zu überzeugen, auch weil sie zu spät kamen, um die Märkte zu überzeugen, dass diese Krise vorbei ist. Der zweite wichtige Aspekt ist: Jetzt sieht es so aus, als könnte sich die Krise langsam beruhigen. Das heißt, die Flammen lodern nicht mehr, sondern es ist nur noch glimmende Glut. Und da hat man zwei Möglichkeiten: Entweder, man nimmt das Risiko in Kauf, dass es wieder loslodert, und fängt erst dann an zu löschen, oder man erstickt die Glut und sorgt dafür, dass das Feuer aus ist.
Wuttke: Wenn Sie ein ganz klein bisschen optimistisch sind, warum fordern dann die OECD plötzlich eine Brandmauer von einer Billion?
Enderlein: Na, aus dem gleichen Grund, den ich gerade angesprochen habe: Es geht ja hier nicht um Geld, das man verliert, es geht um Garantien. Das heißt, Deutschland könnte heute ein Signal setzen und sagen, wir haben es mit dieser Euro-Rettung immer ernst gemeint. Und gerade jetzt am Schluss, wo man merkt, die Krise könnte sich beruhigen, geht es darum zu sagen, jetzt schieben wir noch mal den nötigen Schwung an Garantien hinterher, damit auch klar ist, jetzt ist diese Krise vorbei. Wenn man das jetzt nicht tut, wenn man jetzt wieder zaudert, dann kommt ein Moment, wo wieder die Frage gestellt wird, ja, meinen es die Deutschen denn ernst, ja, wie stehen denn die Deutschen da, wenn plötzlich in Spanien ein Problem entsteht? Und dann ist die Krise ganz automatisch wieder da. In den letzten zwei Jahren haben wir immer dieses Spiel gehabt, dass lange gezaudert wurde, dass oft Entscheidungen zu spät getroffen wurden und dass wir die Krise deshalb über zwei Jahre verschleppt haben. Das hat viel an Wachstumsprozenten gekostet, das hat auf den Aktienmärkten zu deutlichen Einbrüchen geführt, die Unternehmen haben weniger produziert und umgesetzt. Diese Kosten sollten wir auch in Betracht ziehen, wenn wir eine Gesamtbilanz dieser Krise im Augenblick versuchen herzustellen.
Wuttke: Die OECD hat zwar nicht mit zu entscheiden, aber trotzdem ist die Begründung von Generalsekretär Gurría für diese eine Billion doch sehr bemerkenswert: Er hat gesagt, wenn die Märkte 50 erwarten oder 70 verlangen, dann sollte man ihnen 100 geben. Da frage ich mich jetzt ganz salopp mal: Sollten wir das auch noch auf dem Silbertablett tun?
Enderlein: Noch mal: Wir geben das Geld ja nicht aus. Es ist eine Garantie, die Sie aussprechen. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das in Schwierigkeiten ist. Wenn es Konkurrenten gibt, die dieses Unternehmen zerschlagen wollen, dann müssen Sie deutlich machen, wir werden dieses Unternehmen nicht fallen lassen. Und das tun Sie, indem Sie einen höheren Betrag in das Unternehmen stecken als der Betrag, mit dem die anderen gerechnet haben. Das ist so ein bisschen wie beim Pokern.
Wuttke: Aber auch Unternehmen, die nicht fallen gelassen wurden, sind pleite gegangen.
Enderlein: Das ist richtig, aber genau dies können wir uns der Europäischen Union ja so nicht mehr leisten. Wir haben mit Griechenland eine Umstrukturierung durchgeführt, die notwendig war, wo der Privatsektor Geld verloren hat, 70 Prozent des eingesetzten Kapitals, die Banken, wo der Staat kein Geld verloren hat. Weder die Europäische Zentralbank, noch die europäischen Regierungen. Und ich glaube, das ist eine Lösung, auf die wir uns einstellen könnten. Ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Bank, die ohne zu überlegen Portugal oder Griechenland Kredite gegeben hat, heute Verluste macht – ich finde nicht, dass der deutsche Steuerzahler bluten sollte, aber das tut er bislang auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft so kommen wird.
Wuttke: Immerhin, die derzeitige deutsche Haftung liegt bei 211 Milliarden Euro. Welche neue Rechnung für die deutschen Steuerzahler machen Sie denn auf, wenn EFSF und ESM zusammengelegt werden? Was ist denn dann das Garantievolumen?
Enderlein: Also, erst mal muss klar sein: Eine Erhöhung des Rettungsschirms kann es nur geben, wenn die deutschen Garantien steigen. Es wird gerade eine etwas abenteuerliche Debatte darüber geführt, ob der Rettungsschirm größer werden kann durch irgendwelche Tricks, ohne dass die deutschen Garantien steigen. Nein, das geht nicht, ist doch ganz logisch. Das heißt, wenn wir uns darauf einigen, den Rettungsschirm zu erhöhen – und ich habe gerade argumentiert, warum ich glaube, dass das das Richtige ist –, dann muss klar sein, dass der deutsche Garantiebeitrag von 211 Milliarden nach oben geht. Jetzt gibt es unterschiedliche Zielgrößen, 280 Milliarden, 300, 350 Milliarden …
Wuttke: … gibt auch 248, man weiß ja gar nicht, was man glauben soll!
Enderlein: Na gut, es ist gestaffelt. Und ich glaube, am Ende muss die Bundesregierung entscheiden, wie groß der Rettungsschirm, diese neue Brandschutzmauer sein soll. Und daraus liest sich dann der deutsche Garantiebeitrag ab. Wovor ich warnen würde zum jetzigen Zeitpunkt, ist, durch irgendwelche Tricks zu versuchen, um eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen, einen höheren Rettungsschirm zu versprechen und dann am Ende diesen Rettungsschirm, weil die deutschen Garantien nicht zur Verfügung stehen, gar nicht aufbauen zu können. Also, man muss da sehr genau wissen, was man tun möchte. Ich habe viel Verständnis für diejenigen, die sagen, nein, wir wollen diese Rettungsschirme nicht, uns ist es lieber, wenn der Euro kaputtgeht. Ich hielte das für falsch, ich hielte das für gefährlich. Und weil ich das für gefährlich halte, sage ich, wir müssen den Euro retten. Und das tun wir, indem wir einen soliden Rettungsschirm aufbauen, selbst wenn das Garantien in Anspruch nimmt, die über den 211 Milliarden liegen. Das ist im Augenblick der richtige Weg und wir hätten jetzt die Möglichkeit, diese Krise ein für alle Mal zu beenden. Nutzen wir sie!
Wuttke: Aber wie kommen diese unterschiedlichen Rechnungen denn eigentlich zustande, wer nutzt denn da die Statistik wie in seinem Sinne, oder gibt es keine wirklich klaren Zahlen, die auch eine klare Rechnung möglich machen?
Enderlein: Wollen Sie das am frühen Morgen wirklich schon diskutieren?
Wuttke: Das möchte ich!
Enderlein: Es ist technisch etwas komplex: Es gibt den EFSF oder die EFSF, die parallel neben dem ESM, dem Europäischen Rettungsschirm, bestehen soll. Und jetzt ist die Frage, wie viel Gelder die EFSF im Augenblick schon ausgereicht hat und wie viel noch ausreichen wird, ehe sie 2013 geschlossen wird. Der ESM wird Ende des Jahres langsam aufgefüllt mit Geld und wird dann ab 2013 die Aufgaben der EFSF übernehmen. Wenn Sie gleichzeitig aus dem einen Krug Wasser ausgießen und in den anderen Krug Wasser reinschütten, dann können Sie das so machen, dass am Ende die Wassermenge sich nicht ändert, Sie können aber auch beliebig viel Wasser in jeden Krug schütten, wie Sie das für richtig halten. Und deshalb ist der deutsche Garantiebetrag heute einer, den man sehr beliebig festlegen kann. Und daraus liest sich dann am Ende ab, wie groß der Gesamtrettungsschirm ist.
Wuttke: Und eine Zusammenlegung von EFSF und ESM, würde das Bundesverfassungsgericht das gutheißen?
Enderlein: Das müssen Sie die Richter in Karlsruhe fragen.
Wuttke: Was prognostizieren Sie denn?
Enderlein: Auch das Bundesverfassungsgericht muss sich überlegen, was am Ende wichtiger ist. Ob man sagt, der Euro, den wir beschlossen haben, der Teil heute unserer Wirtschaftsverfassung ist, muss geschützt werden, oder ob man sagt, am Ende kommt es darauf an, dass Deutschland keine Garantien für andere Länder übernehmen darf. Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, dass wir das Risiko nicht auf uns nehmen dürfen, den Euro aufs Spiel zu setzen. Es hätte unabsehbare Folgen, wenn der Euro zerbrechen würde. Die Kosten für die deutsche Volkswirtschaft wären ungleich höher, deutlich höher als alle Beträge, über die wir heute reden. Insofern halte ich es für ein Gebot der Stunde, jetzt diesen Rettungsschirm zu beschließen, und ich denke, das wird das Bundesverfassungsgericht am Ende auch so sehen.
Wuttke: Vor der ersten Lesung über den ESM-Rettungsschirm im Bundestag Henrik Enderlein von der Hertie School of Governance im Interview der "Ortszeit" von Deutschlandradio Kultur – ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag!
Enderlein: Ebenfalls schönen Tag, Wiederhören!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Henrik Enderlein: Guten Morgen!
Wuttke: Sie haben schon länger für diese Zusammenlegung plädiert. Warum ist das für Sie die richtige Entscheidung?
Enderlein: Ja, es gibt zwei zentrale Gründe: Der erste ist, dass wir immer noch nicht einen Rettungsschirm haben, der groß genug ist, um den Finanzmärkten klar zu signalisieren, dass in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Portugal und in Irland nichts mehr anbrennen kann. Diese 500 Milliarden, die bislang auf dem Tisch waren, die waren einfach immer zu wenig, um die Märkte zu überzeugen, auch weil sie zu spät kamen, um die Märkte zu überzeugen, dass diese Krise vorbei ist. Der zweite wichtige Aspekt ist: Jetzt sieht es so aus, als könnte sich die Krise langsam beruhigen. Das heißt, die Flammen lodern nicht mehr, sondern es ist nur noch glimmende Glut. Und da hat man zwei Möglichkeiten: Entweder, man nimmt das Risiko in Kauf, dass es wieder loslodert, und fängt erst dann an zu löschen, oder man erstickt die Glut und sorgt dafür, dass das Feuer aus ist.
Wuttke: Wenn Sie ein ganz klein bisschen optimistisch sind, warum fordern dann die OECD plötzlich eine Brandmauer von einer Billion?
Enderlein: Na, aus dem gleichen Grund, den ich gerade angesprochen habe: Es geht ja hier nicht um Geld, das man verliert, es geht um Garantien. Das heißt, Deutschland könnte heute ein Signal setzen und sagen, wir haben es mit dieser Euro-Rettung immer ernst gemeint. Und gerade jetzt am Schluss, wo man merkt, die Krise könnte sich beruhigen, geht es darum zu sagen, jetzt schieben wir noch mal den nötigen Schwung an Garantien hinterher, damit auch klar ist, jetzt ist diese Krise vorbei. Wenn man das jetzt nicht tut, wenn man jetzt wieder zaudert, dann kommt ein Moment, wo wieder die Frage gestellt wird, ja, meinen es die Deutschen denn ernst, ja, wie stehen denn die Deutschen da, wenn plötzlich in Spanien ein Problem entsteht? Und dann ist die Krise ganz automatisch wieder da. In den letzten zwei Jahren haben wir immer dieses Spiel gehabt, dass lange gezaudert wurde, dass oft Entscheidungen zu spät getroffen wurden und dass wir die Krise deshalb über zwei Jahre verschleppt haben. Das hat viel an Wachstumsprozenten gekostet, das hat auf den Aktienmärkten zu deutlichen Einbrüchen geführt, die Unternehmen haben weniger produziert und umgesetzt. Diese Kosten sollten wir auch in Betracht ziehen, wenn wir eine Gesamtbilanz dieser Krise im Augenblick versuchen herzustellen.
Wuttke: Die OECD hat zwar nicht mit zu entscheiden, aber trotzdem ist die Begründung von Generalsekretär Gurría für diese eine Billion doch sehr bemerkenswert: Er hat gesagt, wenn die Märkte 50 erwarten oder 70 verlangen, dann sollte man ihnen 100 geben. Da frage ich mich jetzt ganz salopp mal: Sollten wir das auch noch auf dem Silbertablett tun?
Enderlein: Noch mal: Wir geben das Geld ja nicht aus. Es ist eine Garantie, die Sie aussprechen. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das in Schwierigkeiten ist. Wenn es Konkurrenten gibt, die dieses Unternehmen zerschlagen wollen, dann müssen Sie deutlich machen, wir werden dieses Unternehmen nicht fallen lassen. Und das tun Sie, indem Sie einen höheren Betrag in das Unternehmen stecken als der Betrag, mit dem die anderen gerechnet haben. Das ist so ein bisschen wie beim Pokern.
Wuttke: Aber auch Unternehmen, die nicht fallen gelassen wurden, sind pleite gegangen.
Enderlein: Das ist richtig, aber genau dies können wir uns der Europäischen Union ja so nicht mehr leisten. Wir haben mit Griechenland eine Umstrukturierung durchgeführt, die notwendig war, wo der Privatsektor Geld verloren hat, 70 Prozent des eingesetzten Kapitals, die Banken, wo der Staat kein Geld verloren hat. Weder die Europäische Zentralbank, noch die europäischen Regierungen. Und ich glaube, das ist eine Lösung, auf die wir uns einstellen könnten. Ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Bank, die ohne zu überlegen Portugal oder Griechenland Kredite gegeben hat, heute Verluste macht – ich finde nicht, dass der deutsche Steuerzahler bluten sollte, aber das tut er bislang auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft so kommen wird.
Wuttke: Immerhin, die derzeitige deutsche Haftung liegt bei 211 Milliarden Euro. Welche neue Rechnung für die deutschen Steuerzahler machen Sie denn auf, wenn EFSF und ESM zusammengelegt werden? Was ist denn dann das Garantievolumen?
Enderlein: Also, erst mal muss klar sein: Eine Erhöhung des Rettungsschirms kann es nur geben, wenn die deutschen Garantien steigen. Es wird gerade eine etwas abenteuerliche Debatte darüber geführt, ob der Rettungsschirm größer werden kann durch irgendwelche Tricks, ohne dass die deutschen Garantien steigen. Nein, das geht nicht, ist doch ganz logisch. Das heißt, wenn wir uns darauf einigen, den Rettungsschirm zu erhöhen – und ich habe gerade argumentiert, warum ich glaube, dass das das Richtige ist –, dann muss klar sein, dass der deutsche Garantiebeitrag von 211 Milliarden nach oben geht. Jetzt gibt es unterschiedliche Zielgrößen, 280 Milliarden, 300, 350 Milliarden …
Wuttke: … gibt auch 248, man weiß ja gar nicht, was man glauben soll!
Enderlein: Na gut, es ist gestaffelt. Und ich glaube, am Ende muss die Bundesregierung entscheiden, wie groß der Rettungsschirm, diese neue Brandschutzmauer sein soll. Und daraus liest sich dann der deutsche Garantiebeitrag ab. Wovor ich warnen würde zum jetzigen Zeitpunkt, ist, durch irgendwelche Tricks zu versuchen, um eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen, einen höheren Rettungsschirm zu versprechen und dann am Ende diesen Rettungsschirm, weil die deutschen Garantien nicht zur Verfügung stehen, gar nicht aufbauen zu können. Also, man muss da sehr genau wissen, was man tun möchte. Ich habe viel Verständnis für diejenigen, die sagen, nein, wir wollen diese Rettungsschirme nicht, uns ist es lieber, wenn der Euro kaputtgeht. Ich hielte das für falsch, ich hielte das für gefährlich. Und weil ich das für gefährlich halte, sage ich, wir müssen den Euro retten. Und das tun wir, indem wir einen soliden Rettungsschirm aufbauen, selbst wenn das Garantien in Anspruch nimmt, die über den 211 Milliarden liegen. Das ist im Augenblick der richtige Weg und wir hätten jetzt die Möglichkeit, diese Krise ein für alle Mal zu beenden. Nutzen wir sie!
Wuttke: Aber wie kommen diese unterschiedlichen Rechnungen denn eigentlich zustande, wer nutzt denn da die Statistik wie in seinem Sinne, oder gibt es keine wirklich klaren Zahlen, die auch eine klare Rechnung möglich machen?
Enderlein: Wollen Sie das am frühen Morgen wirklich schon diskutieren?
Wuttke: Das möchte ich!
Enderlein: Es ist technisch etwas komplex: Es gibt den EFSF oder die EFSF, die parallel neben dem ESM, dem Europäischen Rettungsschirm, bestehen soll. Und jetzt ist die Frage, wie viel Gelder die EFSF im Augenblick schon ausgereicht hat und wie viel noch ausreichen wird, ehe sie 2013 geschlossen wird. Der ESM wird Ende des Jahres langsam aufgefüllt mit Geld und wird dann ab 2013 die Aufgaben der EFSF übernehmen. Wenn Sie gleichzeitig aus dem einen Krug Wasser ausgießen und in den anderen Krug Wasser reinschütten, dann können Sie das so machen, dass am Ende die Wassermenge sich nicht ändert, Sie können aber auch beliebig viel Wasser in jeden Krug schütten, wie Sie das für richtig halten. Und deshalb ist der deutsche Garantiebetrag heute einer, den man sehr beliebig festlegen kann. Und daraus liest sich dann am Ende ab, wie groß der Gesamtrettungsschirm ist.
Wuttke: Und eine Zusammenlegung von EFSF und ESM, würde das Bundesverfassungsgericht das gutheißen?
Enderlein: Das müssen Sie die Richter in Karlsruhe fragen.
Wuttke: Was prognostizieren Sie denn?
Enderlein: Auch das Bundesverfassungsgericht muss sich überlegen, was am Ende wichtiger ist. Ob man sagt, der Euro, den wir beschlossen haben, der Teil heute unserer Wirtschaftsverfassung ist, muss geschützt werden, oder ob man sagt, am Ende kommt es darauf an, dass Deutschland keine Garantien für andere Länder übernehmen darf. Das ist keine leichte Frage. Ich glaube, dass wir das Risiko nicht auf uns nehmen dürfen, den Euro aufs Spiel zu setzen. Es hätte unabsehbare Folgen, wenn der Euro zerbrechen würde. Die Kosten für die deutsche Volkswirtschaft wären ungleich höher, deutlich höher als alle Beträge, über die wir heute reden. Insofern halte ich es für ein Gebot der Stunde, jetzt diesen Rettungsschirm zu beschließen, und ich denke, das wird das Bundesverfassungsgericht am Ende auch so sehen.
Wuttke: Vor der ersten Lesung über den ESM-Rettungsschirm im Bundestag Henrik Enderlein von der Hertie School of Governance im Interview der "Ortszeit" von Deutschlandradio Kultur – ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag!
Enderlein: Ebenfalls schönen Tag, Wiederhören!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.