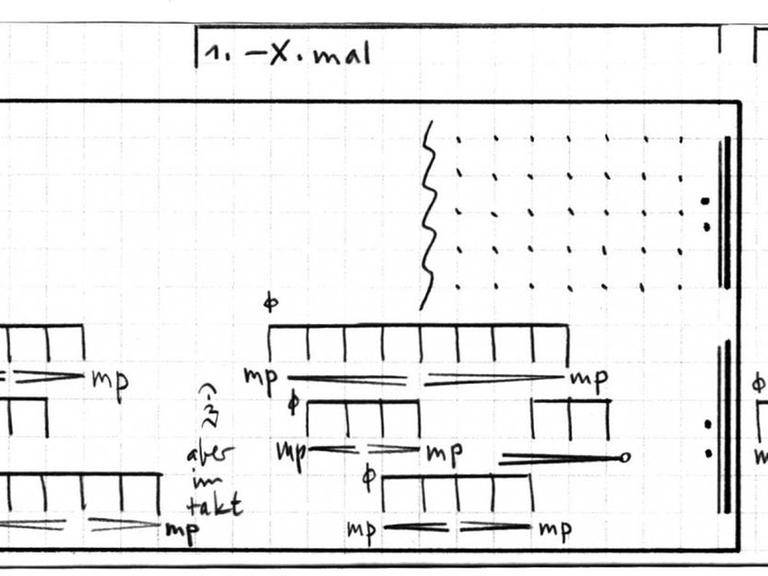Müde von der Theorie
56:24 Minuten

Viele Zeitschriften für neue Musik setzen neuerdings auf ein schrilles Erscheinungsbild. Sind polarisierende Statements, Anekdoten und subjektive Schilderungen wirklich notwendig, um die Leserschaft zu halten?
Seit der Postmoderne sei der Musik die Kritik abhanden gekommen, stellt die Komponistin Isabel Mundry fest. Und tatsächlich sind Veränderungen zu beobachten in den Printmedien, die für die kritische Auseinandersetzung mit Gegenwartsmusik stehen: Theoriebildung, Werkanalysen und musikwissenschaftlich geschulter Journalismus scheinen ins Hintertreffen zu geraten. Gleichzeitig kommen polarisierende Statements, ködernde Titel, Anekdoten und subjektive Schilderungen mehr und mehr in Mode.
Aufmerksamkeit um jeden Preis
Woran liegt das? Nimmt sich in unserem schnelllebigen, von digitalen Kurznachrichten durchwirkten Alltag niemand mehr Zeit für längere, sperrige Artikel? Soll alles breitenwirksam und leicht verdaulich sein? Und muss man als Zeitschriftenmacher um jeden Preis Aufmerksamkeit erregen, da die Printmedien ohnehin auf dem absteigenden Ast sind? Die Meinungen dazu gehen auseinander.
Bastian Zimmermann ist einer der zwei Redakteure der "positionen„. 1988 von Gisela Nauck und Armin Köhler als verlagsunabhängiges, hauptsächlich Szene-internes Medium gegründet, wurde die Zeitschrift 2019 von einem neuen Team übernommen. Mit seinem Kollegen Andreas Engström arbeitet Bastian Zimmermann gezielt daran, neben den Lesern der ersten Stunde auch ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Andreas Engström und Bastian Zimmermann vom Editorial Team der Zeitschrift positionen.© positionen / Else Tunemayr
Die Zeitschrift „positionen“ solle am Puls der Zeit sein, meint Bastian Zimmermann. Und das schlägt sich auch in den Themen der Artikel nieder: Es geht etwa um Self-Curation und Self-Care – also die Selbstvermarktung der Komponisten –, um kollektive musikalische Praktiken, Social Media, Musikstreaming oder Community Building. Eine klassische Werkanalyse oder ein genuin musikwissenschaftlicher Essay ist dazwischen kaum zu finden.
Bewusst gesetzte Neugierlücken
Die „positionen“ sind also vielleicht eher Chronik als musikwissenschaftliche Fachzeitschrift. Und das neue farbige Design ist in der Tat ansprechend, die Titel der Artikel – wie etwa „Webcamsexmusik“ – sind oft provokativ formuliert und kokettieren mit bewusst gesetzten „Neugierlücken“. Sind solche Lockmaßnahmen das neue Geheimrezept für die Attraktivität von Musikzeitschriften? Ist das notwendig, um die Leserschaft zu halten?

Cover der Zeitschrift positionen Nr. 123.© positionen / Archiv
Till Knipper, Chefredakteur der 1934 gegründeten "Neuen Zeitschrift für Musik" des Schott-Verlags, sieht solche Tendenzen kritisch. Gleichzeitig zeigt er Verständnis. Denn gerade in einer Zeit, da Printmedien mit der großen Konkurrenz der Informationsflut im Internet kämpfen, werden Überlebensstrategien gebraucht – zumal es im deutschsprachigen Raum nicht nur eine, sondern vergleichsweise viele Zeitschriften für Gegenwartsmusik gibt.
Leicht zu handhabende Textformate
Das Schreiben über Musik steckt offenbar in einer Krise. Kritik- und Theoriemüdigkeit greifen um sich. Das beobachtet Till Knipper nicht nur von außen, sondern er selbst und seine Zeitschrift sind Teil dieser Entwicklung.
Was der Chefredakteur der „Neuen Zeitschrift für Musik“ Till Knipper beschreibt, hat hin und wieder auch den Effekt, dass Autoren zu Textformaten greifen, die besonders leicht zu handhaben sind. Das Künstlerinterview ist da ein typisches Beispiel: Nur einige wenige Fragen muss man sich ausdenken, der gedankliche Hauptanteil wird dann vom Gesprächspartner bestritten. Und am Ende haben scheinbar alle etwas davon: Der Autor hat wenig Arbeit, der Künstler kann sich selbst so in Szene setzen, wie er es möchte. Und im Schlimmst- oder Bestfall kommen beide vollständig drumherum, langatmige Diskussionen über musikalische Inhalte führen zu müssen.
Was Till Knipper beschreibt, ist ein Problemfeld, mit dem Zeitschriftenmacher sich auseinandersetzen müssen – gerade dann, wenn ihnen zunehmend die Abonnenten, die Einnahmen oder die Subventionen wegbrechen.
Schweiz ohne „dissonance“
Eine Zeitschrift, die den Kampf ums Überleben verloren hat, ist die hauptsächlich vom Schweizerischen Tonkünstlerverein getragene, mehrsprachige "dissonance".
2012 schon hatte das Schweizer Bundesamt für Kultur dem Tonkünstlerverein einen Großteil der Fördermittel gestrichen. In den Folgejahren stiegen weitere Träger aus. 2018 wurde die Zeitschrift eingestellt.
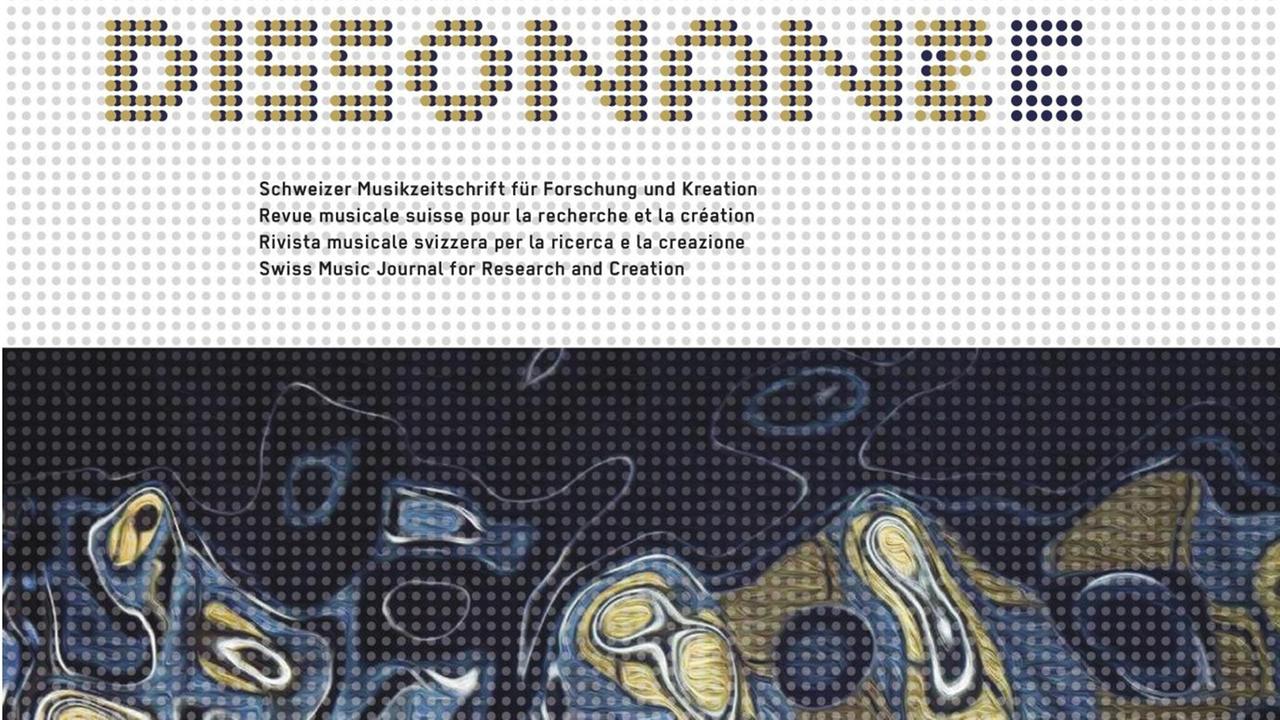
Letztes Cover der Schweizerischen Musikzeitschrift dissonance.© dissonance / Archiv
Man kennt das Bonmot: „Über Musik zu schreiben ist wie über Architektur zu tanzen“. Dem fügte der amerikanische Musikwissenschaftler Robert Walser irgendwann den Gedanken hinzu, dass über Architektur zu tanzen aber ausgesprochen erhellend sein könnte, wenn wir alle so viel tanzten, wie wir Sprache verwenden.
Denn die verbale Darstellung, Zergliederung und Einordnung eines Gegenstands ist nach wie vor ein wertvolles Instrument für Analysen. Dass uns dieses Bewusstsein allerdings abhanden zu kommen scheint, darin sieht der ehemalige dissonance-Redakteur Christoph Haffter ein Problem. Denn das hat zur Folge, dass nur noch bestimmte Texttypen in der Zeitschriftenlandschaft zu finden sind.
Kunst als Kritik
Mittlerweile ist oft schwer zu unterscheiden, welche Erkenntnisse vom Textautor stammen und welche er von den Künstlern übernommen hat. Denn ein sich immer weiter verbreitendes Phänomen in der zeitgenössischen Musik ist die sogenannte „Criticality“ – die direkte Projektion eines kritischen Impetus auf das Künstlerische.
Das heißt: Die Kunst steht der Kritik nicht mehr gegenüber, sondern agiert selbst als Kritik. Der Kommentar, die kritische Reflexion ist zum inhärenten Bestandteil der Kunst geworden. Das geschieht etwa durch Werkkommentare von Komponisten oder sogar durch das unmittelbare Einbinden von Statements in die Musik – etwa durch Texteinspieler, Bilder oder Videoprojektionen mit gesellschaftskritischen oder selbstreflexiven Inhalten.
Echokammer der Selbstinszenierung
Wenn dann das vom Künstler selbst formulierte Statement von Journalisten nur noch kopiert wird, stellt sich tatsächlich die Frage nach der Notwendigkeit. Denn dann wird aus einem kritischen Diskurs nur noch eine Echokammer der immer gleichen Selbstinszenierungen.
Es herrscht offenbar eine allgemeine Angst vor Sperrigkeit, vor allzu großer Ungemütlichkeit von Zeitschriftenartikeln. Christoph Haffters Sichtweise bewegt sich auf dem Grat zwischen Realismus und Idealismus: In seinen Augen ist die unter Zeitschriftenmachern verbreitete Angst vor dem allzu Sperrigen unbegründet, und ein eher künstlich hochgezüchtetes Phänomen.
Wissen und Handwerk, Anspruch und Fleiß
Was Christoph Haffter sich wünscht, erfordert nicht nur einen Wissenshorizont, solides Handwerk, Anspruch und Fleiß, sondern vor allem auch Mut auf der Seite der Autoren – gerade in einer Szene, die so klein und überschaubar ist wie die der zeitgenössischen Musik.
Denn einen Gegenstand sorgfältig zu analysieren oder zu kritisieren, bedeutet immer auch: sich selbst angreifbar zu machen. Gleichzeitig aber ist es keine Frage, dass, wenn ein Kunstwerk tatsächlich etwas zu sagen hat, es auch Kritik aushalten können muss. Und genauso kann wiederum eine fundierte Kritik ihrerseits Gegenkritik aushalten. Kritik, die im Bestfall einen Diskurs anstößt, der die Gedanken- und Ideenwelt weiterbringt.