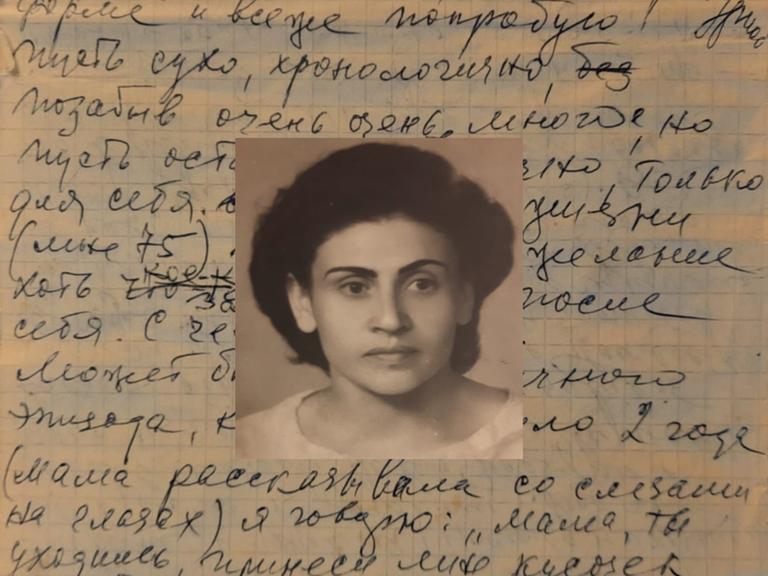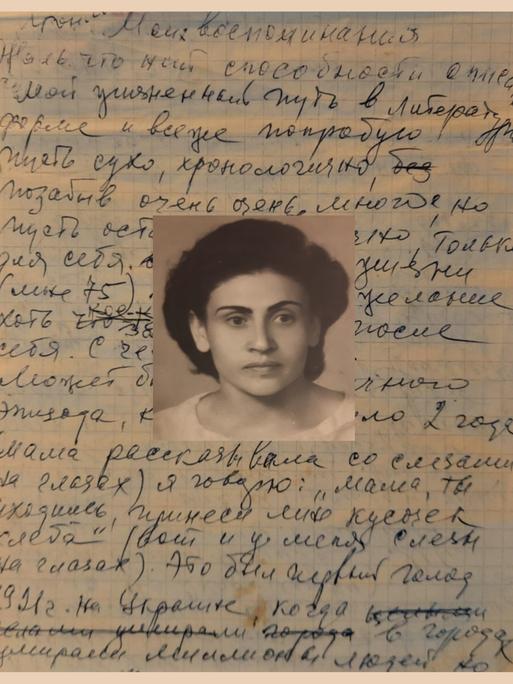Diese Vergangenheitsgerichtetheit des Heimatbegriffs ist ein strukturelles Phänomen. Deswegen ist dieser Begriff auch politisch so einsetzbar und manipulierbar, weil er eigentlich ein emotionales Gemenge beschreibt, aber eben keinen realen Ort.
Krieg und Vertreibung

Zwischen Zufluchtsort und altem Zuhause: Das Gepäck einer Frau und eines Kindes am Anleger der Fähre, die sie zurück nach Orlivka in der Ukraine bringen soll. © picture alliance/ abaca/ Anca Gheonea
Wo und was ist ein Zuhause?
05:24 Minuten

Millionen Menschen fliehen vor Krieg und Vertreibung. Sie alle verlieren ihre vier Wände. Was unterscheidet dabei ein Zuhause von der Heimat? Und wie können wir es wiederfinden?
„Wo auch immer ich bin, mein Zuhause vergesse ich nicht“ – das singen die ukrainischen Musiker Kalush und Skofka in ihrem Lied „dodomu“ – „Nachhause“. Aber was ist das eigentlich – „Zuhause“?
Zuallererst sicher ein physischer Ort: buchstäblich die eigenen vier Wände. Aber natürlich auch weit mehr als das. Familiäre und freundschaftliche Beziehungen, berufliche Tätigkeiten oder auch Freizeitbeschäftigungen sind ebenfalls wichtige Stützen dafür, dass wir uns an einem Ort zuhause fühlen.
Das Zuhause ist ein konkreter Ort
Und ohne den Ort geht es nicht. Das meint jedenfalls Daniel Schreiber, der seine persönliche und philosophische Suche nach dem Zuhause in einem gleichnamigen Essay dokumentiert hat.
„Ich persönlich glaube nicht, dass man ein Zuhause-Gefühl frei von territorialen Denkmustern haben kann oder auch nur definieren oder denken kann", sagt Schreiber. "Das heißt, man muss diesen Ort, an dem wir zu Hause sind, immer mitdenken. Und häufig, wenn man so einen Ort verloren hat, an dem man sich zu Hause gefühlt hat, ist das ein ungeheurer Verlust, ein traumatischer Verlust."

Verust der eigenen vier Wände: Flüchtlinge in einer Unterkunft im Landkreis Peine. © picture alliance/ dpa/ Moritz Frankenberg
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Exilanten von diesem Verlust geprägt. Denker wie der jüdische Philosoph Vilém Flusser dachten über eine befreiende „Wurzellosigkeit“ des Menschen nach.
Heimat entsteht im Rückblick
Diese Abwendung von einem ortsgebundenen hin zu einem ortlosen Denken stand in Abgrenzung zu dem faschistisch aufgeladenen Heimatbegriff. Das Besondere des Begriffs „Heimat“ sieht Daniel Schreiber darin, dass er sich – anders als das „Zuhause“ – gerade nicht auf einen aktuellen, wirklichen Wohn- und Lebensraum bezieht.
Was man betrauert, sind Fantasien
Um diese Gefühle von Verlust zu haben, die mit einer Idee von Heimat einhergehen, muss man eben tatsächlich diesen Ort gar nicht verloren haben. Meistens hat man diesen realen Ort auch gar nicht verloren, sondern was man betrauert sind bestimmte Fantasien, die man mit diesem Ort verbindet.
Heimat ist demnach ein Ort der romantisierten Vergangenheit. Zuhause sind wir dagegen im Hier und Jetzt. Oder vielleicht auch erst in der Zukunft – zumindest, wenn man dem Philosophen Ernst Bloch folgt. Für ihn ist die von menschengemachtem Grauen geprägte Welt des 20. Jahrhunderts keine, in der man heimisch werden könnte. Darum hofft Bloch auf eine gesellschaftliche Weiterentwicklung: Erst in einer zukünftigen, gerechteren Welt könne ein Zuhause entstehen.

Zwischenstopp im Provisorium: Bleibe für Geflüchtete aus der Ukraine in einer Pariser Turnhalle© picture alliance/ abaca/ Christophe Michel
Eine solche, an Bedingungen geknüpfte Bestimmung von Zuhause ermöglicht für den Einzelnen aber nur ein „provisorisches“ Leben. „Und ich glaube, was passiert, ist, dass man sein Leben – das eigentliche Leben – verpasst, wenn man dieses provisorische Leben führt", sagt Daniel Schreiber. "Deswegen würde ich sagen, dass Zuhause nicht in der Zukunft liegt, sondern dass man sich einer inneren Arbeit stellen soll und auch einer äußeren Arbeit an dem Ort, an dem man lebt, um dieses Zuhause-Gefühl gegenwärtig zu machen.“
Geflüchtete brauchen einen Rückzugsort
Diese Arbeit meint vor allem ein Sich-Einlassen auf Menschen, Orte, Kulturen, Sprachen. Die ungezwungene Suche nach einem Zuhause der eigenen Wahl ist jedoch keinesfalls vergleichbar mit der Not, in fremder Umgebung eine Existenz errichten zu müssen:
Gerade in Deutschland wird von Menschen, die migrieren müssen, immer wieder verlangt, sich einer bestimmten "Leitkultur" anzupassen, immer wieder verlangt, auch die Sprache zu lernen. Aber ich glaube, dass dieses Verlangen falsch ist. Denn meistens können wir uns nicht vorstellen, mit welcher Art psychischer Herausforderungen Menschen vor und nach der Flucht konfrontiert sind.
Hannah Arendt beschreibt die Fluchterfahrung als „Zusammenbruch der privaten Welt“. Um diese private Welt wiederaufzubauen, brauchen Geflüchtete einen verlässlichen Rückzugsort ebenso wie das Gefühl, willkommen zu sein.
Das Trauma des Verlusts wird das nicht auslöschen können, das verlorene Zuhause nicht vergessen werden. Aber so kann daneben vielleicht ein neues Zuhause entstehen.