Zurück in die polytechnische Oberschule?
Peter Sloterdijk hat den Titel seines Bestsellers "Du mußt dein Leben ändern" aus einem Rilke-Gedicht entlehnt - und liest darin den Dichter mit den Augen Nietzsches. Der Autor entwirft in dem Buch auch eine neue Anthropologie.
Wer denkt, der neue Sloterdijk würde dem Leser ein poetisches Vergnügen bereiten, der irrt. Er wirbt zwar in seinem Titel mit der letzten Zeile aus Rilkes Gedicht "Archäischer Torso Apollos", aber bereits der Untertitel "Über Anthropotechnik" weist in eine poesieferne Richtung.
Er desillusioniert - wenigstens den Rilke-Verehrer. Der muss sich nach der Lektüre dieses philosophischen Wälzers wieder die Verse in Erinnerung rufen, die ihn so gebannt hatten.
"Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,/ die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern."
Sloterdijk liest Rilke mit den Augen Nietzsches. Gott ist tot und bleibt tot. Apollo, der Oberflächen- und Gestaltgott, wird mit Dionysos, dem Drang- und Strömungsgott, verwoben. Das ist mehr als gut gesehen. Sonst würde ja der Torso nicht wie Raubtierfelle flimmern. In der Interpretation Sloterdijks werden die göttlichen Figuren jedoch vom Olymp heruntergeholt. Glänzend, wie der Autor die Verwandtschaft zwischen Göttern und Athleten in der skulpturalen Kunst der Griechen mit der Renaissance der Olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts verbindet.
Die zeitgemäße Wiederkehr des olympischen Gedankens ist es denn auch, die seiner gesamten Analyse eine Drift ins Technisch-Sportive verleiht. Die Götter mutieren zu Athleten. Religion ist von da an etwas, das man trainieren kann. Keine Gabe, kein Geschenk. Rilkes "Du musst dein Leben ändern" wird zur Basis eines - allerdings höchst aufwendigen - Trainingsprogramms, das den Änderungswilligen zu akrobatischen Übungen ermutigt.
"Das Wort ‚Akrobatik’ verweist auf den griechischen Ausdruck für das Gehen auf Zehenspitzen (von: 'akro', hoch, zuoberst und 'bainein', gehen, schreiten). Es benennt die einfachste Form der natürlichen Gegennatürlichkeit. Vor dem 19. Jahrhundert wurde der Begriff fast ausschließlich für die Hochseil-Akrobatik verwendet, danach auf die meisten anderen Formen der körperlichen Verblüffungskunst ausgeweitet, einschließlich avancierter Gymnastik und entsprechender Zirkusdarbietungen, während die Athletismen und die Extremsportarten die Nähe zur Akrobatik eher zu meiden suchten, so sehr die Verwandtschaft sich aufdrängt."
Die Symbolik der Spannung entleiht Sloterdijk wiederum Nietzsche, der seinem Zarathustra die berühmt gewordene Sentenz in den Mund legt:
"Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde …"
Nietzsches Mensch als Vorbild für die akrobatische Ethik, der Sloterdijk das Wort redet. Virtuos argumentierend und in seiner Souveränität an Max Webers religionssoziologische Studien erinnernd, knüpft der Philosoph aus Karlsruhe Fäden in alle Richtungen. Sämtliche Religionen oder religionsähnlichen Systeme der Welt werden gleichsam aufs Seil gezogen.
Überall wird in ihnen eine vertikale Spannung erkennbar, die jeder Glaubensrichtung zugrunde- bzw. voraus liegt. Sie gehorcht dem Muster einer Evolution, die Natur und Menschen überformt. Das sei der ethische Appell, der auch in Rilkes Versen stecke.
Wir befinden uns in einem Darwin-Jahr. Vom evolutorischen Aspekt ist es nicht weit zu jener Botschaft, die nach dem Urteil des Autors auf westlichem Boden nicht ausgesprochen werden dürfe:
"'Das Göttliche ist erlernbar.' Wie, wenn der Aufstieg zu den Göttern nach sicheren Methoden gemeistert werden könnte? Wenn die Unsterblichkeit nur Übungssache wäre? Wer das glaubt, glaubt auch mit Platon, den indischen Lehrern und den Unsterblichen des Taoismus, ein Mandat zu besitzen, das Unmögliche zu lehren, obschon nie jenseits eines kleinen Kreises von Eingeweihten.
Der Lehrauftrag schließt den Einsatz sämtlicher zur Überwindung der Trägheit geeigneten Mittel ein. Bis wohin das geht, zeigt die lange Reihe der spirituellen und athletischen Extremisten, die in den vergangenen Jahrtausenden das Bild der Menschheit bestimmen."
Die akrobatische Ethik ist eine Ethik des Extremismus, die sich am Unmöglichen misst, um das Ziel des Möglichen möglichst weit hinauszuschieben. So sehr das Niveau der Analysen Sloterdijks an das von Weber erinnert, so wenig spürt man bei ihm das Gefühl eines Verlustes, welches für die Studien des klassischen Religionssoziologen konstitutiv war. Es geht um das Stichwort "Entzauberung". Der Zauber der Religionen ging mit ihnen verloren.
Weber bezeichnete sich selbst zwar als religiös unmusikalisch, war aber doch nichts weniger als anti- oder gar irreligiös. Ganz anders Sloterdijk. In der von ihm angestrebten Schule, dem "Anthropologischen Polytechnikum", vermeiden die ethischen Adepten absichtlich und rigoros, sich den letzten Dingen zu nähern. Typisch dafür die folgende Bemerkung:
"(Der) 'Religion' begegnet (man …) überall, wo das Interesse an Letztversicherung die affektive und ästhetische Besetzung der vorletzten Dinge sabotiert."
Mich dünkt, hier bemüht sich ein Autor von Rang darum, einen großen Autor vor ihm, Ludwig Feuerbach, zu imitieren, d. h. alle Theologie in Anthropologie zu übersetzen. Vermutlich hat der Karlsruher Leistungsethiker bei der Nachahmung seines Vorbilds auch gleich noch dessen Ressentiment gegen die Monarchien von damals übernommen.
Er spricht von der "chronischen Schande Europas, dem Erbadel", und stellt ihm lobend die jahrtausende alte Lernkultur Chinas mit seinem Bildungsadel gegenüber. Und als wäre das nicht schon genug, zieht er an gleicher Stelle auch noch gegen jenen Hof zu Felde, der seinerzeit Vorbild aller Höfe Europas gewesen ist.
"(…) der Hof von Versailles war nur die Spitze eines Archipels nobler Unbrauchbarkeit, der Europa überzog -, und erst die von Bürgern und Virtuosen getragene neo-meritokratische Renaissance zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert hat dem Erbadelsspuk in Europa allmählich ein Ende bereitet, sofern man von den immer noch virulenten Phantomen der Yellow Press absieht."
Das ist fast eine Schimpfkanonade. Die hoch schimpfierte europäische Aristokratie, die Persönlichkeiten vom Schlage Tocquevilles hervorgebracht hat, taugt nicht fürs Polytechnikum. Der polito-soziologische Ansatz des französischen Adligen, der in einer kommoden Religionsausübung das unerlässliche Pfand demokratischer Freiheit erkannte, verfällt dem leistungsethischen Verdikt.
Auch die poetischen Geniestreiche der Dandys zum Beispiel würden nicht zu den akrobatischen Anstrengungen dieser polytechnischen, religionslosen Ethik passen. Sie dürfte für solchen Zauber nichts übrig haben. Dandies gehören - nach der scharfsinnigen Definition Beaudelaires - einer neuen aristokratischen Spezies an, die sich im historischen Spannungsfeld von Aristokratie und Demokratie bewegt.
Möchte Sloterdijk etwa eine gesamtdeutsche Neuauflage des Typs Oberschule aus der DDR? Wo freilich nach strengsten Leistungsmaßstäben unterrichtet wird. Vielleicht wird er der Lehrer der Nicht-Gläubigen. Ob er in die gegenwärtig aufkeimende Konjunktur neuer Religiosität eine Bresche schlägt, bleibt abzuwarten. Ich halte es vorläufig mit dem Albert Einstein zugeschriebenen Diktum: "Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft blind."
Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 2009
Er desillusioniert - wenigstens den Rilke-Verehrer. Der muss sich nach der Lektüre dieses philosophischen Wälzers wieder die Verse in Erinnerung rufen, die ihn so gebannt hatten.
"Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,/ die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern."
Sloterdijk liest Rilke mit den Augen Nietzsches. Gott ist tot und bleibt tot. Apollo, der Oberflächen- und Gestaltgott, wird mit Dionysos, dem Drang- und Strömungsgott, verwoben. Das ist mehr als gut gesehen. Sonst würde ja der Torso nicht wie Raubtierfelle flimmern. In der Interpretation Sloterdijks werden die göttlichen Figuren jedoch vom Olymp heruntergeholt. Glänzend, wie der Autor die Verwandtschaft zwischen Göttern und Athleten in der skulpturalen Kunst der Griechen mit der Renaissance der Olympischen Spiele Ende des 19. Jahrhunderts verbindet.
Die zeitgemäße Wiederkehr des olympischen Gedankens ist es denn auch, die seiner gesamten Analyse eine Drift ins Technisch-Sportive verleiht. Die Götter mutieren zu Athleten. Religion ist von da an etwas, das man trainieren kann. Keine Gabe, kein Geschenk. Rilkes "Du musst dein Leben ändern" wird zur Basis eines - allerdings höchst aufwendigen - Trainingsprogramms, das den Änderungswilligen zu akrobatischen Übungen ermutigt.
"Das Wort ‚Akrobatik’ verweist auf den griechischen Ausdruck für das Gehen auf Zehenspitzen (von: 'akro', hoch, zuoberst und 'bainein', gehen, schreiten). Es benennt die einfachste Form der natürlichen Gegennatürlichkeit. Vor dem 19. Jahrhundert wurde der Begriff fast ausschließlich für die Hochseil-Akrobatik verwendet, danach auf die meisten anderen Formen der körperlichen Verblüffungskunst ausgeweitet, einschließlich avancierter Gymnastik und entsprechender Zirkusdarbietungen, während die Athletismen und die Extremsportarten die Nähe zur Akrobatik eher zu meiden suchten, so sehr die Verwandtschaft sich aufdrängt."
Die Symbolik der Spannung entleiht Sloterdijk wiederum Nietzsche, der seinem Zarathustra die berühmt gewordene Sentenz in den Mund legt:
"Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch - ein Seil über einem Abgrunde …"
Nietzsches Mensch als Vorbild für die akrobatische Ethik, der Sloterdijk das Wort redet. Virtuos argumentierend und in seiner Souveränität an Max Webers religionssoziologische Studien erinnernd, knüpft der Philosoph aus Karlsruhe Fäden in alle Richtungen. Sämtliche Religionen oder religionsähnlichen Systeme der Welt werden gleichsam aufs Seil gezogen.
Überall wird in ihnen eine vertikale Spannung erkennbar, die jeder Glaubensrichtung zugrunde- bzw. voraus liegt. Sie gehorcht dem Muster einer Evolution, die Natur und Menschen überformt. Das sei der ethische Appell, der auch in Rilkes Versen stecke.
Wir befinden uns in einem Darwin-Jahr. Vom evolutorischen Aspekt ist es nicht weit zu jener Botschaft, die nach dem Urteil des Autors auf westlichem Boden nicht ausgesprochen werden dürfe:
"'Das Göttliche ist erlernbar.' Wie, wenn der Aufstieg zu den Göttern nach sicheren Methoden gemeistert werden könnte? Wenn die Unsterblichkeit nur Übungssache wäre? Wer das glaubt, glaubt auch mit Platon, den indischen Lehrern und den Unsterblichen des Taoismus, ein Mandat zu besitzen, das Unmögliche zu lehren, obschon nie jenseits eines kleinen Kreises von Eingeweihten.
Der Lehrauftrag schließt den Einsatz sämtlicher zur Überwindung der Trägheit geeigneten Mittel ein. Bis wohin das geht, zeigt die lange Reihe der spirituellen und athletischen Extremisten, die in den vergangenen Jahrtausenden das Bild der Menschheit bestimmen."
Die akrobatische Ethik ist eine Ethik des Extremismus, die sich am Unmöglichen misst, um das Ziel des Möglichen möglichst weit hinauszuschieben. So sehr das Niveau der Analysen Sloterdijks an das von Weber erinnert, so wenig spürt man bei ihm das Gefühl eines Verlustes, welches für die Studien des klassischen Religionssoziologen konstitutiv war. Es geht um das Stichwort "Entzauberung". Der Zauber der Religionen ging mit ihnen verloren.
Weber bezeichnete sich selbst zwar als religiös unmusikalisch, war aber doch nichts weniger als anti- oder gar irreligiös. Ganz anders Sloterdijk. In der von ihm angestrebten Schule, dem "Anthropologischen Polytechnikum", vermeiden die ethischen Adepten absichtlich und rigoros, sich den letzten Dingen zu nähern. Typisch dafür die folgende Bemerkung:
"(Der) 'Religion' begegnet (man …) überall, wo das Interesse an Letztversicherung die affektive und ästhetische Besetzung der vorletzten Dinge sabotiert."
Mich dünkt, hier bemüht sich ein Autor von Rang darum, einen großen Autor vor ihm, Ludwig Feuerbach, zu imitieren, d. h. alle Theologie in Anthropologie zu übersetzen. Vermutlich hat der Karlsruher Leistungsethiker bei der Nachahmung seines Vorbilds auch gleich noch dessen Ressentiment gegen die Monarchien von damals übernommen.
Er spricht von der "chronischen Schande Europas, dem Erbadel", und stellt ihm lobend die jahrtausende alte Lernkultur Chinas mit seinem Bildungsadel gegenüber. Und als wäre das nicht schon genug, zieht er an gleicher Stelle auch noch gegen jenen Hof zu Felde, der seinerzeit Vorbild aller Höfe Europas gewesen ist.
"(…) der Hof von Versailles war nur die Spitze eines Archipels nobler Unbrauchbarkeit, der Europa überzog -, und erst die von Bürgern und Virtuosen getragene neo-meritokratische Renaissance zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert hat dem Erbadelsspuk in Europa allmählich ein Ende bereitet, sofern man von den immer noch virulenten Phantomen der Yellow Press absieht."
Das ist fast eine Schimpfkanonade. Die hoch schimpfierte europäische Aristokratie, die Persönlichkeiten vom Schlage Tocquevilles hervorgebracht hat, taugt nicht fürs Polytechnikum. Der polito-soziologische Ansatz des französischen Adligen, der in einer kommoden Religionsausübung das unerlässliche Pfand demokratischer Freiheit erkannte, verfällt dem leistungsethischen Verdikt.
Auch die poetischen Geniestreiche der Dandys zum Beispiel würden nicht zu den akrobatischen Anstrengungen dieser polytechnischen, religionslosen Ethik passen. Sie dürfte für solchen Zauber nichts übrig haben. Dandies gehören - nach der scharfsinnigen Definition Beaudelaires - einer neuen aristokratischen Spezies an, die sich im historischen Spannungsfeld von Aristokratie und Demokratie bewegt.
Möchte Sloterdijk etwa eine gesamtdeutsche Neuauflage des Typs Oberschule aus der DDR? Wo freilich nach strengsten Leistungsmaßstäben unterrichtet wird. Vielleicht wird er der Lehrer der Nicht-Gläubigen. Ob er in die gegenwärtig aufkeimende Konjunktur neuer Religiosität eine Bresche schlägt, bleibt abzuwarten. Ich halte es vorläufig mit dem Albert Einstein zugeschriebenen Diktum: "Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft blind."
Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 2009
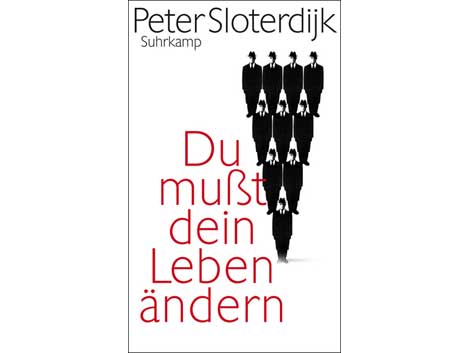
Cover: "Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern"© Suhrkamp
