Zwischen Sandmännchen und Stasi
War die DDR ein soziales Wunschland oder ein purer Überwachungsstaat? Heute haben Schüler ein sehr unterschiedliches Bild von der DDR - je nachdem, ob sie im Osten oder Westen aufgewachsen sind. Klaus Schroeder hat die verschiedenen Sichtweisen im Buch "Soziales Paradies oder Stasi-Staat?" aufgegriffen und zusammengefasst.
Es muss Anfang der achtziger Jahre gewesen sein, als der "Spiegel" aus Aufsätzen bundesdeutscher Schüler über Hitler zitierte. Ihre hanebüchenen Vorstellungen vom Nationalsozialismus schockierten damals die Nation. Inzwischen verlässt in Deutschland keiner mehr die Schule, ohne ausführlich über die NS-Diktatur unterrichtet worden zu sein.
Mit dem Untergang der DDR ist eine neue Vergangenheit herangewachsen. Und wie es scheint, machen wir die alten Fehler wieder. In einer mehr als 700 Seiten starken Studie haben die Berliner Politikwissenschaftler Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder jetzt zutage gefördert, was Schüler in Ost und West über die SED-Diktatur denken. Wenn man die Antworten der Jugendlichen aus Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern liest, muss man sich ernsthaft Sorgen machen.
Nicht einmal ein Drittel aller Schüler weiß, dass die DDR die Mauer gebaut hat. Knapp die Hälfte kann nicht sagen, wann. Viele denken fälschlicherweise, dass in der DDR die Umwelt sauberer, die Lebenserwartung höher und die Einkommen gleich gewesen seien. Wilhelm Pieck oder Willi Stoph sind den meisten völlig unbekannt - ausgerechnet in Ostdeutschland denken viele, es handele sich um westdeutsche Politiker. Umgekehrt meinen viele Schüler, dass Konrad Adenauer, Ludwig Erhard oder Willy Brandt in der DDR gewirkt hätten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis:
"Ein hohes oder sehr hohes Wissen kann nur etwa jedem zehnten befragten Jugendlichen bescheinigt werden, ein niedriges oder sehr niedriges dagegen über 60 Prozent. Einen traurigen Negativrekord stellten die Gesamtschüler auf, von denen fast 80 Prozent nur einen niedrigen Kenntnisstand haben."
Noch wichtiger als Faktenwissen ist die Fähigkeit, den SED-Staat politisch einzuordnen. Mit zahlreichen Fragen haben die Autoren herauszufinden versucht, was junge Menschen über die DDR denken. Gut ein Viertel der befragten Schüler ist der Meinung, die DDR sei keine Diktatur gewesen. Fast jeder Dritte glaubt nicht, dass man politisch überwacht wurde und ohne Grund verhaftet werden konnte. Annähernd 30 Prozent halten die Stasi für einen ganz normalen Geheimdienst. Zwar betrachten 88 Prozent die Todesschüsse an der Grenze als Verbrechen, doch fast jeder Fünfte gibt den Flüchtlingen eine Mitschuld daran. Mehr als ein Drittel schließlich hält den Sozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt worden sei.
Frühere Umfragen haben ähnliche Befunde ergeben. Wer mit Jugendlichen spricht, kann es selber testen: Man muss sie nur fragen, wer Erich Mielke war, und bekommt die verblüffendsten Antworten. Das Neue an der Studie des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin ist ihre große Tiefenschärfe. Erstmals werden die Aussagen der Schüler in Beziehung gesetzt zu Herkunft, Alter, Schultyp und Vorwissen. Dabei ergeben sich aufschlussreiche Zusammenhänge.
Da ist zum einen der Unterschied zwischen Ost und West. In Berlin und Brandenburg - die es ablehnten, die Befragung finanziell zu unterstützen - haben viele Schüler ein dubioses DDR-Bild. Bayerische und nordrhein-westfälische Schüler sehen den SED-Staat dagegen deutlich kritischer. Auch die Akzeptanz der Demokratie ist im Westen höher als im Osten. Bei den Sympathien für den Sozialismus und für eine staatlich gelenkte Wirtschaft ist es umgekehrt. Die Autoren resümieren:
"Ostdeutsche Schüler loben mit breiter Mehrheit die sozialen Seiten des SED-Staates und gleichzeitig neigt eine beträchtliche Minderheit unter ihnen zur Ausblendung diktatorischer und repressiver Aspekte. Westdeutsche Schüler einschließlich der bayerischen sprechen - wenn auch in abgeschwächter Form - der DDR bei einigen sozialen Dimensionen des Lebens ebenfalls ein Lob aus, erkennen aber mit sehr breiter Mehrheit den Diktaturcharakter dieses Staates."
Die zweite Erkenntnis lautet, dass die Meinung der Schüler von ihrem Wissen abhängt. Wer viel über die DDR weiß, sieht sie kritischer. Wer wenig weiß, neigt zur Verklärung. Die Urteile einer studentischen Kontrollgruppe sind deshalb durchweg negativer als die der Schüler. Westdeutsche Schüler wussten erstaunlicherweise mehr Fragen zur DDR richtig zu beantworten als ihre ostdeutschen Altersgenossen. Sogar die bayerischen Hauptschüler waren den Gymnasiasten aus Brandenburg überlegen.
Eine der Ursachen für die Defizite sind die Lehrpläne. Meist taucht die DDR dort nur unsystematisch als Unterthema zum Ost-West-Konflikt auf. Das kommunistische System als solches wird kaum behandelt. In Bayern ist das anders, wie die Autoren hervorheben:
"Generell sehen die Lehrpläne für alle drei Schularten in Bayern eine umfassende Behandlung der DDR vor und fordern mehr oder weniger ausdrücklich deren Betrachtung aus dem Blickwinkel einer freiheitlich-demokratischen Werteordnung."
Große Differenzen gibt es zudem bei den Schulbüchern. Aus Sicht der Autoren ist nur das Buch "Geschichte plus" zufriedenstellend.
Entscheidend für das DDR-Bild der Schüler sind schließlich die Lehrer. Mehr als zwei Drittel aller Schüler sagen, dass sie entgegen den Lehrplänen wenig oder gar nichts über den SED-Staat im Unterricht gelernt hätten. Vor allem in Ostdeutschland gibt es Widerstände. Manche Lehrer beschönigten dort im Gespräch mit den Autoren die DDR, stellten sogar historische Fakten in Frage. Die Verfasser berichten:
"Einige Lehrer mit DDR-Sozialisation relativieren zumindest die negativen Seiten der DDR, indem sie nur über die ihrer Meinung nach positiven Aspekte dieses Staates reden. Für sie birgt die Behandlung des Themas 'DDR' im Schulunterricht die Gefahr, dass die DDR nur als Diktatur und nicht als eine 'normale' Gesellschaft abgehandelt würde."
Umso wichtiger ist eine qualifizierte Ausbildung der Geschichtslehrer. Aus dem Unterrichtskanon der Universitäten ist die DDR jedoch weitgehend verschwunden. Zugleich zeigt die Forschung nach Ansicht der Autoren selber einen zunehmenden Trend zur Weichzeichnung. Statt über Diktatur und Unterdrückung wollten viele lieber über Alltag und Bindungskräfte in der DDR schreiben. Eine maßgebliche Rolle spiele dabei das Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschungen, in dem zahlreiche ehemalige DDR-Historiker Unterschlupf gefunden haben. Dort bagatellisiere man die SED-Diktatur mit Begriffen wie "Fürsorgediktatur" oder "Konsensdiktatur". Die bundesdeutsche Forschung nähere sich damit wieder ihren Irrtümern aus der Zeit vor 1989.
Diese Entwicklung dürfte mit dem allgemeinen Stimmungswandel zusammenhängen. Die Autoren führen ihn anhand von langfristigen Umfragen unter Erwachsenen vor Augen. 1990 hielten nur 19 Prozent der Ostdeutschen die DDR-Verhältnisse für "ganz erträglich", 2001 war schon fast die Hälfte dieser Meinung. Die DDR wird langsam wieder salonfähig, was sich nicht zuletzt in den Wahlergebnissen der Linkspartei niederschlägt.
Für die Bildungspolitik, vor allem im Osten Deutschlands, sind die Ergebnisse der Studie ein Armutszeugnis. Die Verantwortlichen sind aufgefordert, dem Trend zur DDR-Verharmlosung durch wirksame Maßnahmen entgegenzutreten. Aber auch Eltern und Wissenschaftler, Journalisten und Politiker müssen verstärkt Aufklärung betreiben. Sonst glauben bald alle die groteske Schilderung eines Mannes, der den Autoren schrieb, die Opfer der Stasi hätten ihren Überwachern in der DDR sogar heißen Tee ans Auto gebracht.
Klaus Schroeder / Monika Deutz-Schroeder:
Soziales Paradies oder Stasi-Staat?
Das DDR-Bild von Schülern - Ein Ost-West-Vergleich
Ernst Vögel Verlag, Stamsried
Mit dem Untergang der DDR ist eine neue Vergangenheit herangewachsen. Und wie es scheint, machen wir die alten Fehler wieder. In einer mehr als 700 Seiten starken Studie haben die Berliner Politikwissenschaftler Klaus Schroeder und Monika Deutz-Schroeder jetzt zutage gefördert, was Schüler in Ost und West über die SED-Diktatur denken. Wenn man die Antworten der Jugendlichen aus Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern liest, muss man sich ernsthaft Sorgen machen.
Nicht einmal ein Drittel aller Schüler weiß, dass die DDR die Mauer gebaut hat. Knapp die Hälfte kann nicht sagen, wann. Viele denken fälschlicherweise, dass in der DDR die Umwelt sauberer, die Lebenserwartung höher und die Einkommen gleich gewesen seien. Wilhelm Pieck oder Willi Stoph sind den meisten völlig unbekannt - ausgerechnet in Ostdeutschland denken viele, es handele sich um westdeutsche Politiker. Umgekehrt meinen viele Schüler, dass Konrad Adenauer, Ludwig Erhard oder Willy Brandt in der DDR gewirkt hätten. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis:
"Ein hohes oder sehr hohes Wissen kann nur etwa jedem zehnten befragten Jugendlichen bescheinigt werden, ein niedriges oder sehr niedriges dagegen über 60 Prozent. Einen traurigen Negativrekord stellten die Gesamtschüler auf, von denen fast 80 Prozent nur einen niedrigen Kenntnisstand haben."
Noch wichtiger als Faktenwissen ist die Fähigkeit, den SED-Staat politisch einzuordnen. Mit zahlreichen Fragen haben die Autoren herauszufinden versucht, was junge Menschen über die DDR denken. Gut ein Viertel der befragten Schüler ist der Meinung, die DDR sei keine Diktatur gewesen. Fast jeder Dritte glaubt nicht, dass man politisch überwacht wurde und ohne Grund verhaftet werden konnte. Annähernd 30 Prozent halten die Stasi für einen ganz normalen Geheimdienst. Zwar betrachten 88 Prozent die Todesschüsse an der Grenze als Verbrechen, doch fast jeder Fünfte gibt den Flüchtlingen eine Mitschuld daran. Mehr als ein Drittel schließlich hält den Sozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt worden sei.
Frühere Umfragen haben ähnliche Befunde ergeben. Wer mit Jugendlichen spricht, kann es selber testen: Man muss sie nur fragen, wer Erich Mielke war, und bekommt die verblüffendsten Antworten. Das Neue an der Studie des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin ist ihre große Tiefenschärfe. Erstmals werden die Aussagen der Schüler in Beziehung gesetzt zu Herkunft, Alter, Schultyp und Vorwissen. Dabei ergeben sich aufschlussreiche Zusammenhänge.
Da ist zum einen der Unterschied zwischen Ost und West. In Berlin und Brandenburg - die es ablehnten, die Befragung finanziell zu unterstützen - haben viele Schüler ein dubioses DDR-Bild. Bayerische und nordrhein-westfälische Schüler sehen den SED-Staat dagegen deutlich kritischer. Auch die Akzeptanz der Demokratie ist im Westen höher als im Osten. Bei den Sympathien für den Sozialismus und für eine staatlich gelenkte Wirtschaft ist es umgekehrt. Die Autoren resümieren:
"Ostdeutsche Schüler loben mit breiter Mehrheit die sozialen Seiten des SED-Staates und gleichzeitig neigt eine beträchtliche Minderheit unter ihnen zur Ausblendung diktatorischer und repressiver Aspekte. Westdeutsche Schüler einschließlich der bayerischen sprechen - wenn auch in abgeschwächter Form - der DDR bei einigen sozialen Dimensionen des Lebens ebenfalls ein Lob aus, erkennen aber mit sehr breiter Mehrheit den Diktaturcharakter dieses Staates."
Die zweite Erkenntnis lautet, dass die Meinung der Schüler von ihrem Wissen abhängt. Wer viel über die DDR weiß, sieht sie kritischer. Wer wenig weiß, neigt zur Verklärung. Die Urteile einer studentischen Kontrollgruppe sind deshalb durchweg negativer als die der Schüler. Westdeutsche Schüler wussten erstaunlicherweise mehr Fragen zur DDR richtig zu beantworten als ihre ostdeutschen Altersgenossen. Sogar die bayerischen Hauptschüler waren den Gymnasiasten aus Brandenburg überlegen.
Eine der Ursachen für die Defizite sind die Lehrpläne. Meist taucht die DDR dort nur unsystematisch als Unterthema zum Ost-West-Konflikt auf. Das kommunistische System als solches wird kaum behandelt. In Bayern ist das anders, wie die Autoren hervorheben:
"Generell sehen die Lehrpläne für alle drei Schularten in Bayern eine umfassende Behandlung der DDR vor und fordern mehr oder weniger ausdrücklich deren Betrachtung aus dem Blickwinkel einer freiheitlich-demokratischen Werteordnung."
Große Differenzen gibt es zudem bei den Schulbüchern. Aus Sicht der Autoren ist nur das Buch "Geschichte plus" zufriedenstellend.
Entscheidend für das DDR-Bild der Schüler sind schließlich die Lehrer. Mehr als zwei Drittel aller Schüler sagen, dass sie entgegen den Lehrplänen wenig oder gar nichts über den SED-Staat im Unterricht gelernt hätten. Vor allem in Ostdeutschland gibt es Widerstände. Manche Lehrer beschönigten dort im Gespräch mit den Autoren die DDR, stellten sogar historische Fakten in Frage. Die Verfasser berichten:
"Einige Lehrer mit DDR-Sozialisation relativieren zumindest die negativen Seiten der DDR, indem sie nur über die ihrer Meinung nach positiven Aspekte dieses Staates reden. Für sie birgt die Behandlung des Themas 'DDR' im Schulunterricht die Gefahr, dass die DDR nur als Diktatur und nicht als eine 'normale' Gesellschaft abgehandelt würde."
Umso wichtiger ist eine qualifizierte Ausbildung der Geschichtslehrer. Aus dem Unterrichtskanon der Universitäten ist die DDR jedoch weitgehend verschwunden. Zugleich zeigt die Forschung nach Ansicht der Autoren selber einen zunehmenden Trend zur Weichzeichnung. Statt über Diktatur und Unterdrückung wollten viele lieber über Alltag und Bindungskräfte in der DDR schreiben. Eine maßgebliche Rolle spiele dabei das Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschungen, in dem zahlreiche ehemalige DDR-Historiker Unterschlupf gefunden haben. Dort bagatellisiere man die SED-Diktatur mit Begriffen wie "Fürsorgediktatur" oder "Konsensdiktatur". Die bundesdeutsche Forschung nähere sich damit wieder ihren Irrtümern aus der Zeit vor 1989.
Diese Entwicklung dürfte mit dem allgemeinen Stimmungswandel zusammenhängen. Die Autoren führen ihn anhand von langfristigen Umfragen unter Erwachsenen vor Augen. 1990 hielten nur 19 Prozent der Ostdeutschen die DDR-Verhältnisse für "ganz erträglich", 2001 war schon fast die Hälfte dieser Meinung. Die DDR wird langsam wieder salonfähig, was sich nicht zuletzt in den Wahlergebnissen der Linkspartei niederschlägt.
Für die Bildungspolitik, vor allem im Osten Deutschlands, sind die Ergebnisse der Studie ein Armutszeugnis. Die Verantwortlichen sind aufgefordert, dem Trend zur DDR-Verharmlosung durch wirksame Maßnahmen entgegenzutreten. Aber auch Eltern und Wissenschaftler, Journalisten und Politiker müssen verstärkt Aufklärung betreiben. Sonst glauben bald alle die groteske Schilderung eines Mannes, der den Autoren schrieb, die Opfer der Stasi hätten ihren Überwachern in der DDR sogar heißen Tee ans Auto gebracht.
Klaus Schroeder / Monika Deutz-Schroeder:
Soziales Paradies oder Stasi-Staat?
Das DDR-Bild von Schülern - Ein Ost-West-Vergleich
Ernst Vögel Verlag, Stamsried
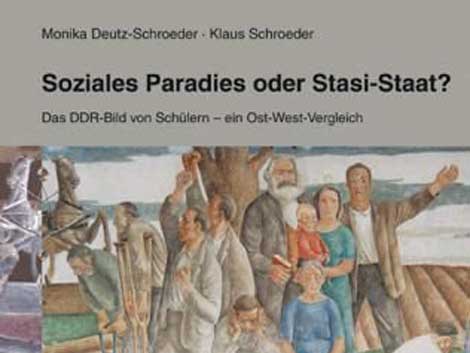
Deutz-Schroeder/Schroeder: "Soziales Paradies oder Stasi-Staat?"© Ernst-Vögel-Verlag
